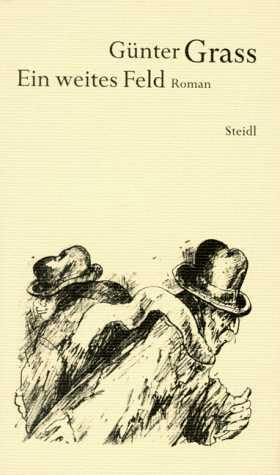![Ein weites Feld]()
Ein weites Feld
Napoleonischen Marschälle von Ney bis Rapp, ließ sich der andere, nun als Reichsbannermann, von seinem elfjährigen Sohn den Kopf verbinden, wenn er nach Saalschlachten mit randalierenden SA-Männern nach Hause kam. Beide Väter hatten Reste revolutionärer Ideen über Niederlagen hinweggerettet. Beide scheiterten zwar beruflich und als Ehemänner, doch ließen sie von ihren weltbeglückenden Entwürfen nicht ab. Sie hatten es mit Prinzipien. Der eine hielt Napoleon die Treue, der andere schwankte zwischen Bebel und Bernstein, blieb aber unbeirrbar dem Genossenschaftswesen verschworen. Erst als sie von Frau und Kindern getrennt und allein für sich lebten, fanden sie zu Tätigkeiten, die ihren nie recht ausgelebten Neigungen Auslauf boten; der eine züchtete nahe Freienwalde, am überwachsenen alten Flußufer der Oder, mit mäßigem Gewinn Mastschweine und verkaufte zu günstigem Preis die in seinen Sandäckern reichlich vorrätigen Feldsteine an eine Straßenbaufirma, die im Brandenburgischen meilenlange Chausseen mit zerkleinertem Gestein pflasterte; der andere hatte nach unruhigem Hin und Her, das nur von einer halbjährigen Schutzhaft im Konzentrationslager Oranienburg unterbrochen wurde, als Hausmeister und Gärtner in Berlin-Grunewald Unterschlupf gefunden. Dort besorgte er eine schloßähnlich verschnörkelte Villa, die an der Ecke Königsallee, Hasensprung hinter hohen Bäumen versteckt lag und dennoch im Bombenkrieg, mit Ausnahme der Kellerwohnung des Hausmeisters Max Wuttke, schwer beschädigt wurde. So lebten, überlebten sie. Beide alleinstehenden Väter haben, als sie schon an die Sechzig waren, der eine im Oderbruch, der andere in einst vornehmer Villenlage, Frauen in ihre Kätnerhütte, in ihr wohnliches Kellerloch aufgenommen, die, wenn die Söhne in unregelmäßigen Abständen auf Besuch kamen, nahe der Oder als »Haushälterin«, am Hasensprung 35 als »meine Altersgenossin« den Tisch deckten. Beide Frauen waren in mittlerem Alter, die eine galt als »gute Person, mitunter allerdings schrecklich, aber bei Lichte besehen ist alles mal schrecklich …«, von der anderen hieß es: »Sie redet nicht viel, aber was sie sagt, hat Hand und Fuß, selbst wenn es daneben greift oder fehltritt …« Beide Frauen kochten gerne. Die eine verwertete alles vom Schwein: von der Schnauze übers Nackenstück bis zu den Spitzbeinen; die andere bereitete Kaninchen zu: gebraten, geschmort oder zerkleinert als Pfeffer. Kaninchen gab es genug. Max Wuttke züchtete, wie einst im Neuruppiner Schrebergarten, Blaue Wiener und andere Stallhasen, doch diesmal in großer, die Lebenskosten deckender Zahl. Das weitläufige Gartengelände, das sanft geneigt bis zum verschilften Dianasee abfiel, lieferte Grünfutter genug. So waren beide Väter endlich zur Ruhe gekommen. Sogar dem Spiel und dem Alkohol hatten sie abgeschworen. Der eine erwartete seinen Sohn in grauer Leinenhose und in schon lange nicht mehr gewechseltem Hemd unterm Drillichrock, der andere stand mit oft geflickter Gärtnerschürze über blaugrauer Cordhose und in Holzschuhen am Gartentor.
Als Fonty in einem Zwischenkapitel über den Vater des Unsterblichen schrieb, war ihm sein eigener so nahe, daß er, nach üblichem Hin und Her auf der Teppichbrücke, beide Väter miteinander befreundete. Manchmal verwechselte er sie. Und weil er ihnen so viele Gemeinsamkeiten zuschrieb, glichen sie einander wie Zwillinge aus Neigung. Nun täuschten sie ihre Söhne, sobald diese als Besuch am Tisch saßen. Jedenfalls kam es vor, daß Fonty den einen meinte, wenn er vom anderen sprach, indem er beiden nur Gutes nachrief. Soviel Verständnis für zwei altgewordene Eigenbrötler. Soviel liebevoller Zuspruch für zwei schwadronierende Käuze. Und soviel gehäufter Gewinn auf Kosten der in Distanz geratenen Mütter, für die nur Respekt blieb, denn immer noch fürchtete er deren zwiefach bewiesene Strenge; nur die Väter – verkrachte Existenzen wie er standen ihm jederzeit nahe. Als der Erstgeborene im Sommer 1867 seinen Vater in der ehemaligen Schifferkolonie nahe Freienwalde besuchte, war er annähernd fünfzig Jahre alt, wurde aber dennoch vom Einundsiebzigjährigen als »mein Jung« begrüßt und erst ein wenig später als »nun auch schon betagter Knabe« erkannt; der Unsterbliche schrieb damals noch für die Kreuzzeitung und saß überm zweiten Kriegsbuch, das den Krieg gegen Österreich abhandelte. Der ehemalige Apotheker und spätere Schweinezüchter belächelte seines
Weitere Kostenlose Bücher