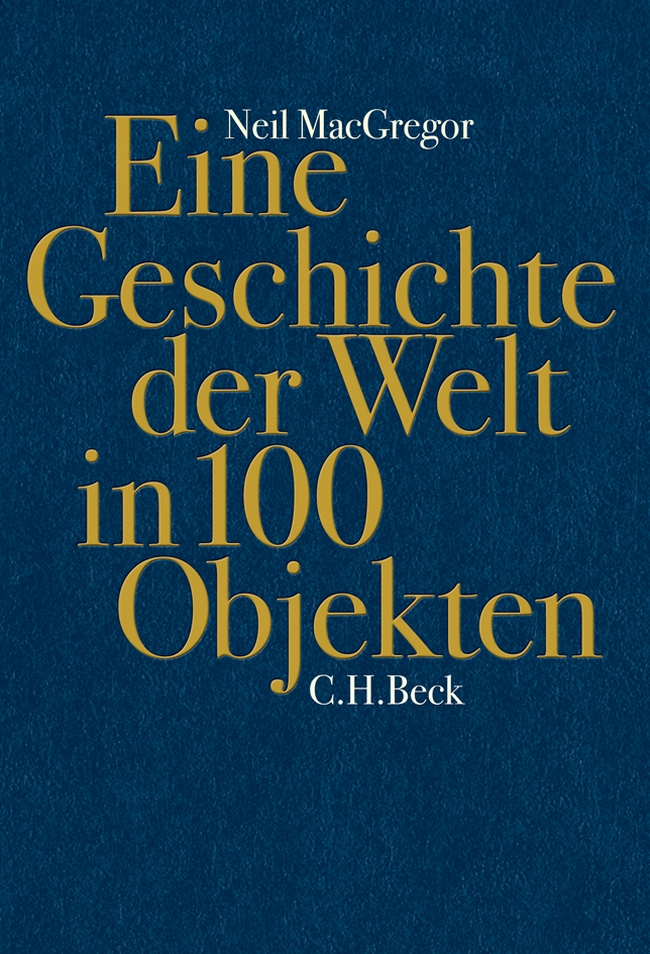![Eine Geschichte der Welt in 100 Objekten]()
Eine Geschichte der Welt in 100 Objekten
Brücke, die diesen Fußboden möglich machte. Bevor der Kaiser konvertierte, hätte es kein Villenbesitzer gewagt, seinen christlichen Glauben so offen zur Schau zu stellen – praktizierende Christen hatte man verfolgt. Doch nun war alles anders. Dame Averil Cameron, Professorin an der Universität Oxford, erklärt:
«Kaiser Konstantin soll kurz vor der Schlacht am Himmel ein Kreuz erschienen sein, das ihn offenbar zum Christentum bekehrte. In der Folgezeit jedenfalls wurde Konstantin nicht müde, dem Christentum Privilegien zu verschaffen, was eine komplette Kehrtwende gegenüber der Zeit bedeutete, als das Christentum sogar verboten gewesen war. Er privilegierte christliche Priester steuerlich, mischte sich in christliche Diskussionen ein, erklärte das Christentum zu einer legalen Religion, ließ christlichen Kirchen Geld zukommen und begann selbst christliche Kirchen zu bauen. All das gab dem Christentum enormen Auftrieb.»
Diese Entwicklung muss auch unserem Villenbesitzer das Vertrauen verschafft haben, Christus so darstellen zu können, dass er den Betrachter en face anblickt, unzweifelhaft ein Mann von Macht. Er trägt die edle Kleidung und die modische Haartracht, die möglicherweise auch der Villenbesitzer selbst pflegte, aber es handelt sich eben nicht um einen lokalen Herrscher und schon gar nicht um einen lokalen Gott. Das Chi-Rho-Monogramm macht deutlich, dass man es hier mit Jesus Christus zu tun hat. Und es gibt noch einen anderen Hinweis auf das wahre Wesen dieses Mannes: Zu beiden Seiten von Christi Haupt hat der Künstler Granatäpfel platziert. Den gebildeten Besucher dürfte das sofort an den Mythos von Persephone erinnert haben, die in die Unterwelt verschleppt, von ihrer Mutter gerettet und zurück ins Land der Lebenden gebracht wurde. Während ihres Aufenthalts in der Unterwelt hatte Persephone einige Kerne eines Granatapfels gegessen und musste deshalb fortan einen Teil des Jahres in Dunkelheit verbringen. Ihr Mythos ist eine große Allegorie auf den Kreislauf der Jahreszeiten, auf Tod und Wiedergeburt, auf den Abstieg in die Hölle und die Rückkehrzum Licht. Indem er diese schlichte Frucht hinzufügt, verknüpft der Künstler Jesus mit den heidnischen Göttern, die ebenfalls Götter des Sterbens und der Wiederkehr gewesen waren – Orpheus, der auf der Suche nach Eurydike in die Unterwelt kam und zurückkehrte, und Bacchus, der in ähnlicher Weise mit der Vorstellung von einer Wiederauferstehung verbunden war. Dieser Christus aus Dorset vereint in sich all die Hoffnungen der Antike und die tiefste aller menschlichen Hoffnungen: dass der Tod nur Teil einer viel größeren Geschichte ist, die in Lebensfülle und noch größerer Fruchtbarkeit gipfeln wird.
Wir wissen nicht, in was für einem Raum sich dieses Mosaik befand. In großen römischen Villen waren die besten Mosaike üblicherweise im Speisezimmer zu finden, doch in diesen Fall ist das eher unwahrscheinlich. Es gab keine Fußbodenheizung in diesem Raum, und er ging nach Norden, es wäre also viel zu kalt gewesen, um in Dorset dort zu speisen. Normalerweise geben die Wände ebenso wie der Boden Hinweise darauf, welchem Zweck ein Raum diente, doch die Wände dieses Raumes sind schon lange verschwunden. Eine Möglichkeit klingt allerdings verführerisch: Die Christusgestalt blickt gen Osten, und zwischen ihr und der Wand wäre gerade genug Platz für einen Altar gewesen. Vielleicht fungierte dieser Raum als frühe Hauskapelle.
Die Menschen waren oft irritiert angesichts der Vorstellung, Christus auf einem Fußboden abzubilden, und nicht anders erging es damals den Römern. Im Jahr 427 verbot der Kaiser explizit Darstellungen von Christus in Fußbodenmosaiken und befahl, alle bereits existierenden zu entfernen. Doch zu dieser Zeit gehörte Britannien schon nicht mehr zum Römischen Reich. Die Villa in Hinton St. Mary war von ihren Besitzern wahrscheinlich verlassen worden, und aus diesem Grund blieb der Fußboden dort intakt. Insgesamt gesehen bedeutete der Abzug römischer Macht eine kulturelle Katastrophe, doch in diesem konkreten Fall sollten wir vielleicht dankbar sein.
45
Arabische Bronzehand
Bronzehand, aus dem Jemen
100–300 n. Chr.
In den vorangegangenen Kapiteln haben wir uns mit bildlichen Darstellungen von Buddha, Hindugöttern und Jesus Christus befasst. Nun haben wir es mit einer rechten Hand zu tun, in Bronze gegossen, doch handelt es sich nicht um die Hand eines Gottes, sondern um eine Gabe an einen Gott. Es ist
Weitere Kostenlose Bücher