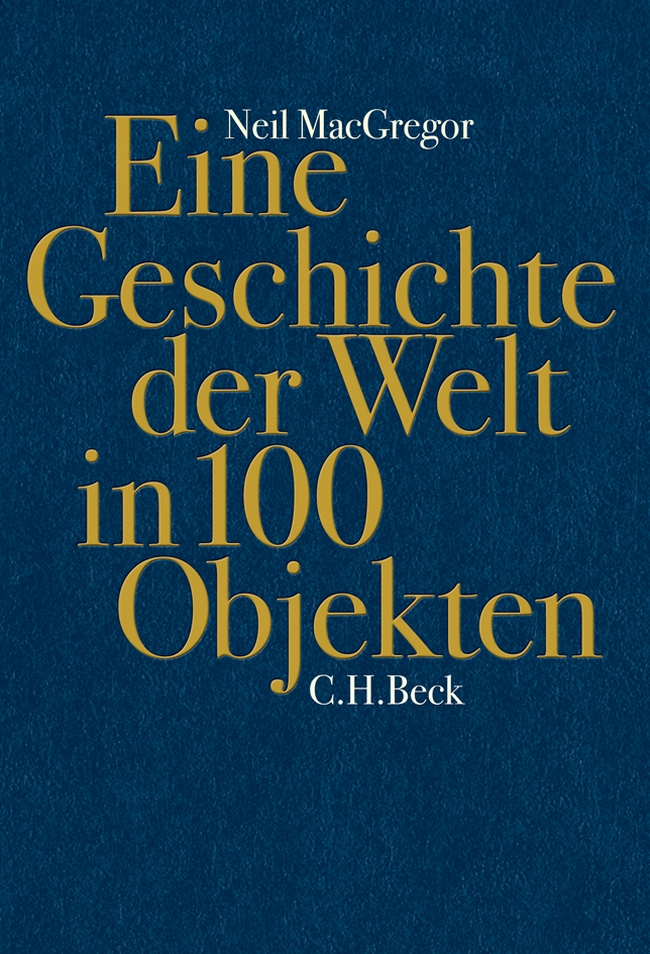![Eine Geschichte der Welt in 100 Objekten]()
Eine Geschichte der Welt in 100 Objekten
im Jahr 11 nach muslimischer und 632 nach christlicher Zeitrechnung entstanden und stammen aus Syrien, China, England, Peru und Korea. Und sie erlauben Einblicke in die jeweilige Interaktion von Macht und Glauben an diesen Orten.
In den fünfzig Jahren nach dem Tod des Propheten zerstörten die arabischen Truppen den politischen Status quo im gesamten Nahen und Mittleren Osten, als sie Ägypten und Syrien, Irak und Iran eroberten. Der Einfluss des Islam hatte sich damit binnen weniger Jahrzehnte so weit ausgebreitet, wie das Buddhismus und Christentum erst nach Jahrhunderten gelungen war. Mitte der 690er Jahre müssen die Menschen in Damaskus das deutliche Gefühl gehabt haben, dass sich ihre Welt gerade komplett veränderte. Die Stadt wirkte nach außen noch immer wie eine christlich-römische Metropole, doch nach der Eroberung durchmuslimische Truppen 635 war sie zur Hauptstadt eines neuen islamischen Reiches geworden. Das Oberhaupt dieses expandierenden Imperiums, der Kalif, thronte weit weg in seinem Palast, und die islamischen Truppen hausten abgeschieden in ihren Unterkünften, doch die Menschen auf den Basaren und in den Straßen von Damaskus erlebten die neue Wirklichkeit ganz unmittelbar anhand dessen, was sie jeden Tag in Händen hielten – Geld.
Anfang der 690er Jahre hatten die Kaufleute in Damaskus möglicherweise noch gar nicht so richtig begriffen, dass sich ihre Welt dauerhaft verändert hatte. Trotz bereits jahrzehntelanger islamischer Herrschaft verwendeten sie noch immer die Münzen ihrer früheren Regenten, der christlich-byzantinischen Kaiser, und diese Münzen steckten voller christlicher Symbolik. Es war durchaus vernünftig anzunehmen, der Kaiser werde früher oder später zurückkehren und seine Gegner besiegen, wie er das schon des Öfteren getan hatte. Doch diesmal kam es anders. Damaskus ist bis heute eine muslimische Stadt, und das vielleicht deutlichste Zeichen dafür, dass dieses neue islamische Regime von Dauer sein sollte, war neues, anderes Münzgeld.
Der Mann, der die beiden hier in Rede stehenden Münzen herausgab, war Abd al-Malik, der als neunter Kalif oder Beherrscher der Gläubigen in der Nachfolge des Propheten Mohammed regierte. Beide Münzen wurden innerhalb von zwölf Monaten in Damaskus ausgegeben, in den Jahren 76 und 77 islamischer Zeitrechnung (also 696/697 n. Chr.). Sie bestehen beide aus Gold und haben in etwa die Größe eines britischen Ein-Penny-Stücks, sind allerdings ein wenig schwerer. Gestaltet jedoch sind sie ganz unterschiedlich. Eine Münze zeigt den Kalifen; die andere weist gar keine bildliche Darstellung auf. Diese Veränderung macht deutlich, dass sich der Islam in diesen entscheidenden frühen Jahren nicht nur als religiöses, sondern auch als politisches System verstand.
Auf der Vorderseite der ersten Münze, auf der eine byzantinische Münze den Kaiser präsentiert hätte, findet sich der Kalif Abd al-Malik in voller Größe abgebildet. Es handelt sich um die früheste Darstellung eines Muslimen, die wir kennen. Und auf der Rückseite, wo die Byzantiner ein Kreuz platziert hätten, sehen wir eine Säule mit einer Kugel oben drauf.
Abd al-Malik wird in voller Gestalt gezeigt, stehend und mit Bart; er trägt typisch arabische Kleidung und ein Beduinentuch als Kopfbedeckung; seineHand ruht auf einem Schwert an seiner Hüfte. Es ist eine faszinierende Darstellung – eine einzigartige Quelle für unser Wissen um Kleidung und Insignien der ersten Kalifen. Seine Haltung wirkt drohend, er sieht aus, als würde er gleich sein Schwert ziehen. Die Linien unterhalb seiner Hüfte sollen mit ziemlicher Sicherheit eine Peitsche darstellen. Dieses Bild soll Furcht und Respekt einflößen, es soll deutlich machen, dass der östliche Mittelmeerraum nunmehr einen neuen Glauben und einen formidablen neuen Herrscher hat.
In einem Brief eines seiner Gouverneure klingt die implizite Botschaft dieser Darstellung ebenfalls an:
«Es handelt sich um Abd al-Malik, den Anführer der Gläubigen, einen Mann ohne Schwächen, von dem Aufrührer keine Nachsicht erwarten dürfen! Wer sich ihm widersetzt, der bekommt seine Peitsche zu spüren!»
Dieser Brief zeichnet ein eindrucksvolles Bild des Kalifen – auch wenn eine weniger ehrerbietige Quelle davon berichtet, er habe dermaßen entsetzlichen Mundgeruch, dass man ihn den «Fliegentöter» nenne. Doch schlechter Atem hin oder her – Abd al-Malik war der bedeutendste muslimische Führer seit Mohammed, denn er machte aus
Weitere Kostenlose Bücher