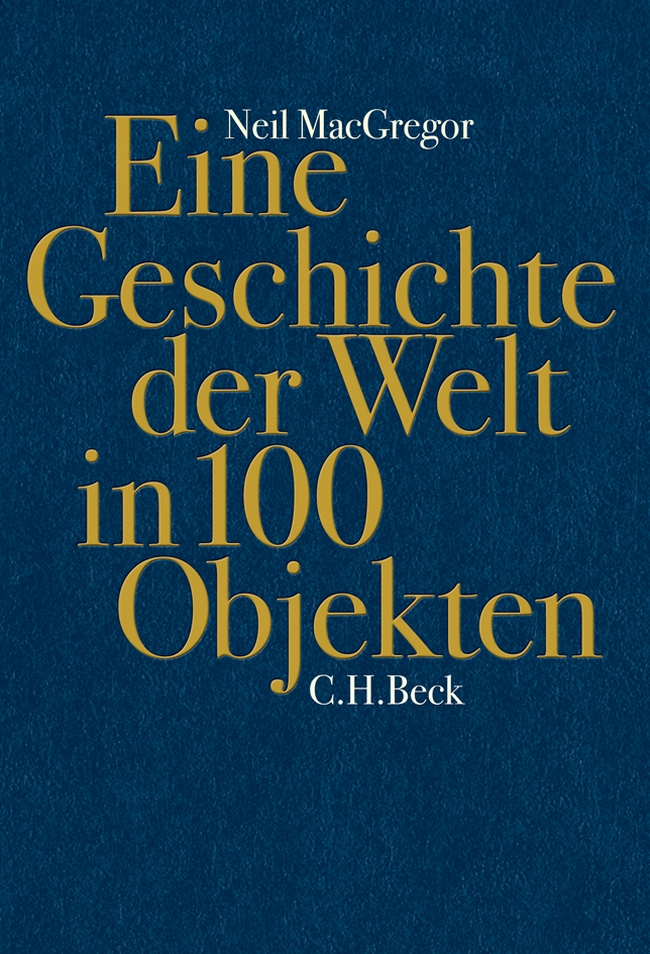![Eine Geschichte der Welt in 100 Objekten]()
Eine Geschichte der Welt in 100 Objekten
lebt in der Kultur fort. Ich glaube, in gewisser Weise haben die Koreaner das Gefühl, dass es sich dabei um ein Wesen handelt, um eine Art Mutterfigur. In diesem Sinne ist die Silla-Zeit eine der wichtigsten Epochen in der koreanischen Geschichte.»
Doch trotz weiter bestehender Straßenmuster und ausgeprägter kultureller Kontinuitäten wird nicht jeder im heutigen Korea das Vermächtnis der Silla-Zeit auf die gleiche Weise verstehen oder gar die Silla als Mutterkultur begreifen. Jane Portal erläutert, welche Bedeutung ihr heute zukommt:
«Was die Koreaner heute über die Silla-Zeit denken, hängt davon ab, wo sie leben. Für Südkoreaner steht die Silla-Epoche für den stolzen Moment, da man die Aggression aus China zurückschlug, was bedeutete, dass sich die koreanische Halbinsel unabhängig von China entwickeln konnte. Nordkoreaner hingegen haben das Gefühl, die Silla-Zeit sei historisch überschätzt, denn tatsächlich vereinte das damalige Königreich nur die südlichen zwei Drittel der Halbinsel. Was Silla bedeutet, hängt also davon ab, auf welcher Seite der Demilitarisierten Zone man lebt.»
Zu den vielen Fragen, die heute zwischen Nord- und Südkorea umstritten sind, gehört nicht zuletzt die, was vor 1300 Jahren wirklich geschehen ist. Wie so oft gilt auch hier: Wie man Geschichte liest, hängt davon ab, woraus man sie liest.
50
Malerei einer Seidenprinzessin
Seidenmalerei, aus der Provinz Xinjiang, China
600–800 n. Chr.
Es war einmal in längst vergangenen Zeiten, da gab es eine wunderschöne Prinzessin, die im Land der Seide lebte. Eines Tages ließ ihr Vater, der Kaiser, sie wissen, sie müsse den König aus dem fernen Land der Jade heiraten. Der Jadekönig konnte keine Seide herstellen, denn der Kaiser behielt dieses Geheimnis für sich. Und so beschloss die Prinzessin, ihrem neuen Volk die Seide als Geschenk zu bringen. Dazu dachte sie sich einen Trick aus: Alles, was dafür vonnöten war – die Seidenraupen, die Maulbeersamen, einfach alles –, versteckte sie in ihrem königlichen Kopfschmuck. Sie wusste, die Wachen ihres Vaters würden es niemals wagen, sie zu durchsuchen, als sie sich aufmachte in ihre neue Heimat. Und das, meine Liebste, ist die Geschichte, wie der König von Khotan zu seiner Seide kam.
Das ist meine Version einer «Nur-so»-Geschichte, die einen der größten Technologiediebstähle in der Historie erklären soll. Man kennt sie als die «Legende von der Seidenprinzessin», und sie wird uns hier als Malerei auf einem Holzbrett präsentiert, die rund 1300 Jahre alt ist. Sie befindet sich heute im Britischen Museum, doch gefunden hat man sie in einer schon lange verlassenen Stadt an der sagenumwobenen Seidenstraße.
In der Welt um 700, einer Welt, in der Menschen und Waren viel unterwegs waren, nahm eine der belebtesten Straßen, damals wie heute, ihren Anfang in China: die Seidenstraße – wobei es sich nicht um eine einzelne Straße handelte, sondern um ein Netz von Karawanenrouten, die eine Strecke von rund 6500 Kilometern umfassten und den Pazifik mit dem Mittelmeer verbanden. Die Waren, die auf dieser Straße transportiert wurden, waren rar und exotisch – Gold, Edelsteine, Gewürze, Seide. Und mit den Waren kamen Geschichten, Vorstellungen, Glaubensüberzeugungen und – Kern der Geschichte, die uns hier interessiert – Technologien.
Diese Malerei stammt aus dem Oasenkönigreich Khotan in Zentralasien. Khotan liegt heute im Westen Chinas, doch im 8. Jahrhundert war es ein eigenes Königreich und ein bedeutsamer Knotenpunkt der Seidenstraße, wichtig wegen seines Wasser und als Rastplatz und zudem einer der großen Seidenproduzenten. Geschichtenerzähler aus Khotan schufen eine Legende, um zu erklären, wie die Geheimnisse der Seidenproduktion – jahrtausendelang ein chinesisches Monopol – nach Khotan gelangt waren. Heraus kam die Geschichte von der Seidenprinzessin, wie sie unsere Malerei erzählt.
Das Holzbrett, auf das die Geschichte gemalt ist, fand man in einem kleinen, verlassenen buddhistischen Schrein in Khotan. Er gehörte zu einer kleinen Stadt aus Schreinen und Klöstern, die über tausend Jahre lang unter dem Sand begraben war und Ende des 19. Jahrhunderts von dem Universalgelehrten Sir Aurel Stein wiederentdeckt wurde, einem der ersten Archäologen der Seidenstraße. Stein war es denn auch, der die Bedeutung von Khotan als Handels- und Kulturzentrum zu Tage brachte.
Das Bild ist auf ein unbearbeitetes Brett aufgemalt, das ziemlich genau
Weitere Kostenlose Bücher