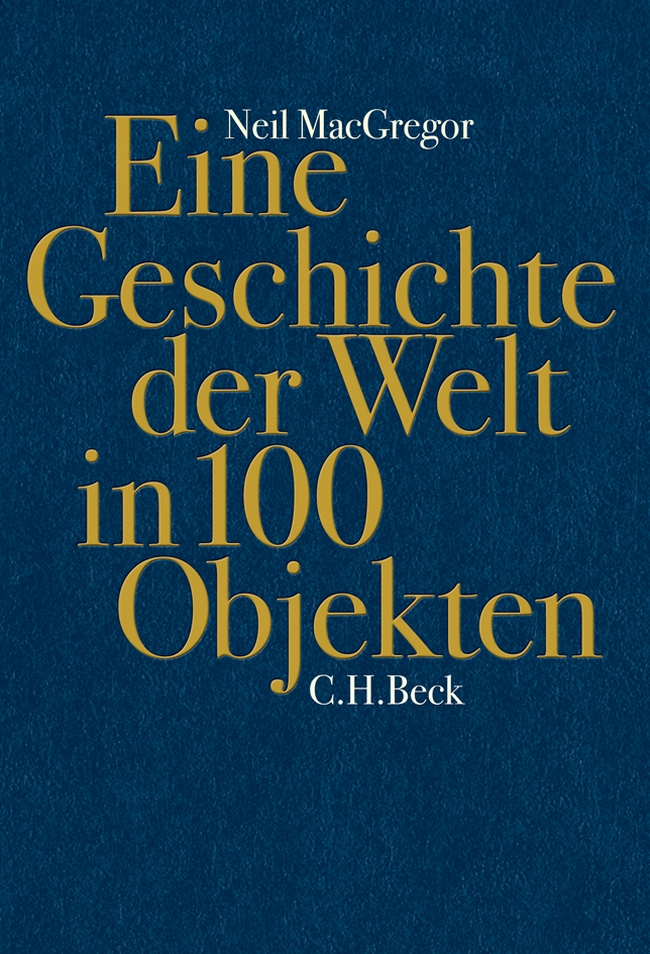![Eine Geschichte der Welt in 100 Objekten]()
Eine Geschichte der Welt in 100 Objekten
Jahren, die folgten, für eine großartige Blüte der Kunst. Unser Kristall ist ein prachtvolles Beispiel für diese sogenannte Karolingische Renaissance.
Er ist ein Juwel, das fast immer wertgeschätzt worden ist. Seit seiner Anfertigung hatte man ihn die meiste Zeit über im Kloster von Waulsort, im heutigenBelgien, im Zentrum des Reiches von Karl dem Großen aufbewahrt. Er befand sich zweifellos im 12. Jahrhundert dort, denn die Klosterchronik von damals beschreibt ihn eindeutig:
Die abschließenden Szenen des Kristalls zeigen, wie die Alten zu Tode gesteinigt werden und wie Susanna für unschuldig erklärt wird.
«Dieser begehrenswerte Schatz wurde im Auftrag des ruhmreichen Lothar, König der Franken, angefertigt. Ein Beryll in der Mitte enthält eine Darstellung nach dem Buche Daniel, in der Susanna von den alten Richtern böswillig verurteilt wird. [Der Stein] zeigt uns hohe Kunstfertigkeit durch die Vielfalt seiner Bearbeitung.»
Er blieb vermutlich in Waulsort, bis Truppen des revolutionären Frankreich das Kloster in den 1790er Jahren plünderten. Vielleicht waren sie es, die den Kristall – offenkundig für das Königtum gemacht, das sie verachteten – in die nahegelegene Maas warfen. Als er gefunden wurde, war er gesprungen, aber ansonsten vollkommen unversehrt, da Bergkristall erstaunlich widerstandsfähig ist. Er ist sehr hart und kann nicht gemeißelt werden, sondern muss mit Schleifpulvern bearbeitet werden. Für die ganze Sache war eine Menge Zeit und große Kunstfertigkeitnötig, weshalb Kristalle wie dieser als Luxusobjekte galten. Wir wissen nicht, für welchen Zweck unser Susanna-Kristall ursprünglich gedacht war – möglicherweise als Dankesgabe für einen Schrein –, aber er war in jedem Fall ein Objekt, das eines Königs würdig war.
Zu der Zeit, als der Kristall entstand, war das Reich Karls des Großen zusammengebrochen. Nordwesteuropa war unter drei Mitgliedern seiner zänkischen und wahrlich dysfunktionalen Familie aufgeteilt. Die Streitereien führten letztlich dazu, dass sich das Reich in drei Teile spaltete: ein östliches Königreich, das später zu Deutschland wurde, ein westliches Königreich, das künftige Frankreich, und Lothars «Mittelreich», genannt Lotharingien, welches sich vom heutigen Belgien aus über die Provence bis hinunter nach Italien erstreckte. Dieses Mittelreich war immer das schwächste von den dreien, ständig bedroht von den arglistigen Onkeln auf beiden Seiten. Lotharingien musste dazu in der Lage sein, sich selbst zu verteidigen: Es brauchte einen starken König.
Rosamond McKitterick, Professorin für mittelalterliche Geschichte an der Universität Cambridge; schildert die Ausgangslage:
«Wir wissen fast nichts über den Hof Lothars des Zweiten, ganz einfach deshalb, weil die meisten unserer Quellen, die ihm gewidmet sind, zwei bestimmten Kategorien angehören. Eine besteht aus narrativen Quellen, die die Verwundbarkeit seines eigenen kleinen Königreichs im mittleren Westen darlegen und die ostfränkischen Königreiche beschreiben, von wo seine Onkel, Karl der Kahle im Westen und Ludwig der Deutsche im Osten, ihre gierigen Augen auf sein Herrschaftsgebiet richteten. Die andere Kategorie hat viel mehr Bezug zu diesem Kristall, denn sie handelt von den Versuchen, die Lothar anstellte, um seine Frau Theutberga loszuwerden. Er scheint sie sehr bald nachdem er den Thron geerbt hatte, geheiratet zu haben, wenngleich er eine langjährige Geliebte mit dem Namen Waldrada hatte, die von ihm einen Sohn und eine Tochter empfing. Als er Theutberga heiratete, hatte sie keine Kinder, und sie gebar auch weiterhin keine. Lothar entschied, wie es scheint, dass Waldrada die bessere Partie wäre. Also beauftragte er zwei seiner Bischöfe, den von Köln und den von Trier, seine Ehe annullieren zu lassen, mit der Begründung, Theutberga unterhalte eine inzestuöse Beziehung zu ihrem Bruder.»
Lothars Versuch, sich von seiner Ehefrau scheiden zu lassen und seine Geliebte zu heiraten, war keine selbstsüchtige Laune: Er brauchte einen legitimen Erben,durch den sich ihm die einzige Chance bot, sein Erbe und sein Königreich zu bewahren. Aber eine königliche Scheidung war heute wie damals politischer Zündstoff.
Die Bischöfe von Köln und Trier hatten der Königin, womöglich durch Folter, tatsächlich das Geständnis abgerungen, dass sie Inzest mit ihrem Bruder begangen hatte. Aber Theutberga wandte sich an den Papst, der den Fall untersuchte und sie für unschuldig
Weitere Kostenlose Bücher