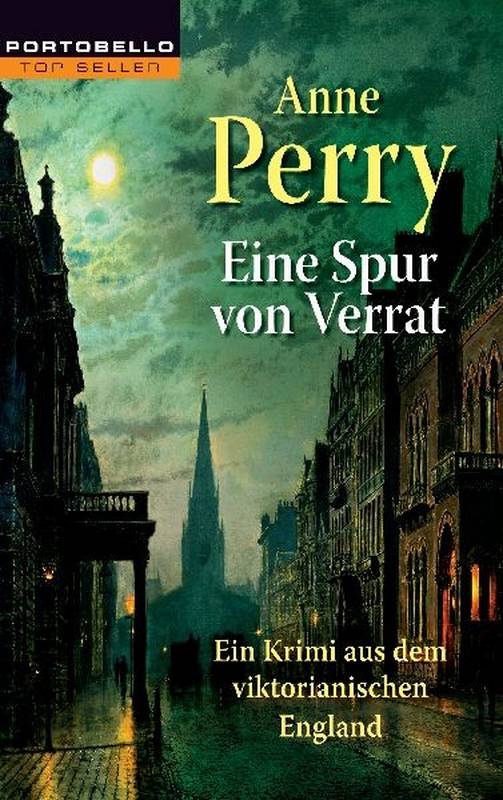![Eine Spur von Verrat]()
Eine Spur von Verrat
Niederlage einstecken«, meinte sein Vater und widmete sich wieder seinem Teller.
»Selbst wenn du als Sieger hervorgehen solltest, wird es am Ende nur ein recht bedeutungsloser Triumph sein, fürchte ich. Wem würde es nützen? Es demonstriert lediglich, daß Oliver Rathbone die Wahrheit herausfinden und vor allen Leuten ausbreiten kann, auch wenn die unglückliche Angeklagte lieber hängen würde, als sie selbst preiszugeben.«
»Ohne ihre Erlaubnis werde ich gewiß nichts dergleichen tun«, versicherte Oliver mit hochrotem Kopf, die dunklen Augen vor Fassungslosigkeit geweitet. »Wofür in aller Welt hältst du mich eigentlich?«
»Für einen rechten Hitzkopf zuweilen, mein Junge«, erwiderte Henry gelassen. »Der von einer geistigen Überheblichkeit und einer Wißbegierde durchdrungen ist, die er – leider Gottes – von mir geerbt haben muß.«
Der weitere Abend nahm einen äußerst angenehmen Verlauf. Sie sprachen über die verschiedensten Dinge, die nichts mit dem Fall Carlyon zu tun hatten. Eine Weile unterhielten sie sich über Musik, wofür jeder von ihnen eine Menge übrig hatte. Henry Rathbone entpuppte sich als regelrechter Kenner mit einer speziellen Vorliebe für Beethovens späte Quartette, die entstanden waren, als Beethoven sein Gehör schon fast vollständig verloren hatte. Für Henry besaßen sie etwas Düsteres und Vielschichtiges, das er unendlich ausfüllend fand, eine dem Leid abgetrotzte Schönheit, die sein Mitgefühl erregte, zugleich aber in eine tiefere Ebene seines Wesens vordrang und eine dort schlummernde Sehnsucht stillte.
Ein zweites Thema waren die politischen Tagesereignisse inklusive der zunehmenden Unruhen in Indien. Den Krimkrieg streiften sie nur ganz kurz, denn Henry Rathbone war über die Inkompetenz der Generäle und das unsinnige Sterben derart erbost, daß Hester und Oliver nur einen flüchtigen Blick wechselten und das Gespräch sofort in andere Bahnen lenkten.
Ehe Hester aufbrach, machten sie und Oliver noch einen ausgedehnten Spaziergang über das Grundstück, hinunter bis zu der Geißblatthecke am Rande des Obstgartens. Der Duft der ersten Blüten hing schwer und süß im dunstigen Abenddunkel. Die Silhouette der längsten, gen Himmel strebenden Äste zeichnete sich schwach vor dem sternenklaren Himmel ab. Ausnahmsweise sprachen sie einmal nicht über den Fall.
»Die Neuigkeiten aus Indien sind furchtbar«, sagte Hester, den Blick auf die blassen, verschwommenen Flecken gerichtet, die bei Tageslicht Apfelblüten waren. »Hier ist es so friedlich, daß der Gedanke an Aufstände und Kämpfe gleich doppelt schmerzt. Ich habe ein richtig schlechtes Gewissen, daß um mich herum soviel Schönes ist…«
Er stand so dicht hinter ihr, daß sie die Wärme seines Körpers spüren konnte. Es war ein durch und durch angenehmes Gefühl.
»Das brauchen Sie nicht«, gab er zurück. Sie wußte, daß er lächelte, obwohl sie mit dem Rücken zu ihm stand. Sein Gesicht hätte sie in der Finsternis ohnehin nicht klar erkannt. »Sie können den Menschen in Indien kaum helfen«, fuhr er fort, »indem Sie das verachten, was Sie haben. Das wäre nichts anderes als undankbar.«
»Da haben Sie natürlich recht. Es ist eine Art Selbstkasteiung, um das Gewissen zu beruhigen, führt aber außer zu Undankbarkeit, wie Sie sagen, im Grunde zu nichts. Auf der Krim bin ich regelmäßig abseits von den Schlachtfeldern durch die Gegend gelaufen. Ich wußte genau, was sich da ganz in meiner Nähe abgespielt hatte, und brauchte doch die Stille und die Blumen, um weitermachen zu können. Wenn man sich seine körperliche und geistige Kraft nicht bewahrt, ist man nicht mehr in der Lage, anderen zu helfen. Mein Verstand weiß das sehr gut.«
Er nahm sacht ihren Ellbogen und dirigierte sie auf den Kräutergarten zu, wo sich majestätische Lupinenkerzen kaum wahrnehmbar von den fahlen Steinen der Mauer abhoben; dazwischen rankte schemenhaft eine Kletterrose.
»Üben Ihre aussichtslosen Fälle ein ähnliche Wirkung auf Sie aus?« fragte Hester. »Oder betrachten Sie das Ganze eher von der nüchternen Seite? Sagen Sie – verlieren Sie eigentlich oft?«
»Das sicher nicht.« Ein Lachen schwang in seiner Stimme mit.
»Ab und zu müssen Sie doch verlieren!«
Das Lachen verschwand. »Ja, natürlich. Und ja – ich liege nachts manchmal wach und male mir aus, wie sich der Gefangene in dem Moment fühlen mag; unterwerfe mich der gedanklichen Folter, ob ich auch alles, wirklich alles für ihn getan habe;
Weitere Kostenlose Bücher