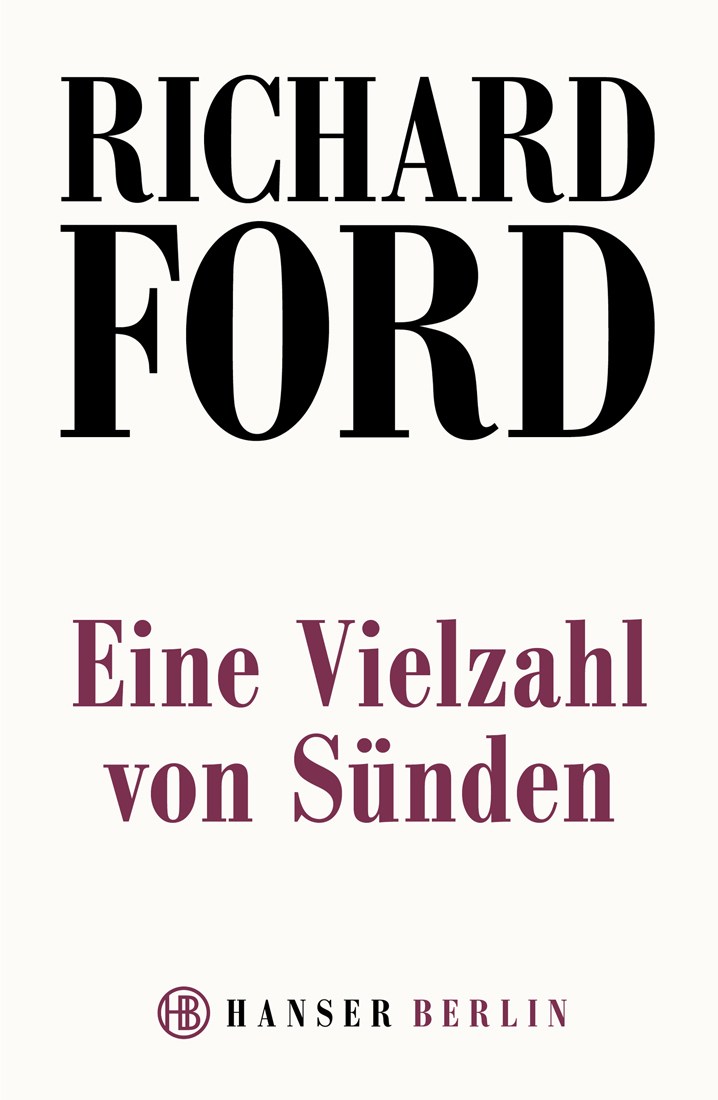![Eine Vielzahl von Sünden]()
Eine Vielzahl von Sünden
gespenstischen Rumpelakkord, wie wenn es im Film gruselig wird.
Ich nahm an, er hätte das erfunden, obwohl das natürlich nicht stimmte. »Was soll das heißen?«, fragte ich.
»Das Übliche«, sagte er mit immer noch baumelnder Zigarette im Mund. »Pass auf, wenn du eine Besichtigung der Hölle buchst. Nichts Neues.«
»Wann hast du dieses Buch gelesen?«, sagte ich, zwischen den beiden halb geschlossenen Schiebetüren stehend. Dieser Mann war der Liebhaber meiner Mutter, ihr Svengali, ihr Impresario, ihr Verführer und ihr Verderben (wie sich bald zeigen sollte). Er war ein seltsamer Mann voller Kraft, der etwas vom Leben gesehen hatte, das ich niemals sehen würde. Und ich bin mir sicher, ich hatte zugleich Angst vor ihm und Angst davor, er könnte genau das bemerken, was mich wahrscheinlich überheblich und unverschämt wirken ließ und mir seine Abneigung sicherte.
Dubinion schaute über die Tastatur hinweg auf ein Gesteck aus rotem Feuerdorn, das meine Mutter arrangiert hatte. »Nun, ich könnte jetzt etwas Gemeines sagen. Das tue ich aber nicht.« Er holte tief Luft und atmete ebenso tief wieder aus. »Du lies einfach weiter. Und ich – ich spiele einfach weiter.« Er nickte, schaute mich aber nicht mehr an. Danach gab es nicht mehr viele Gespräche zwischen uns. Meine Mutter schickte ihn noch im Winter weg. Ein- oder zweimal kam er wieder, aber irgendwann verschwand er. Doch bis dahin hatte sich ihr Leben ohnehin schon so zum Schlechten verändert, wie es wahrscheinlich unvermeidlich gewesen war.
Ich kann mich nur an ein einziges Mal erinnern, dass meine Mutter in diesen zwei Tagen direkt das Wort an mich richtete – abgesehen von bloßen Mitteilungen, etwa dass das Abendessen fertig sei oder dass sie abends zu einem Auftritt gehen wolle, den Dubinion für sie arrangiert hatte, den sie wiederum garantiert dafür bezahlt hatte (so wie sie auch für die Chance zu singen bezahlte) –, nämlich am Mittwochnachmittag, als ich auf der hinteren Veranda saß und über dem Merkblatt mit den Aufnahmebedingungen brütete, das ich mir aus Lawrenceville hatte schicken lassen. Ich hatte Lawrenceville noch nie gesehen, war noch nie in New Jersey gewesen, überhaupt war ich von New Orleans aus nur bis Yankeetown in Florida gelangt, wo meine Militärschule in einem ehemaligen katholischen Hospital für kranke und verrückte Priester untergebracht war. Aber ich glaubte, dass Lawrenceville – allein schon das Wort – mich aus der unmöglichen Situation erretten könne, in der ich mich sah. Nach Lawrenceville zu fahren, die vielen Meilen im Zug zu reisen und diese Welt namens New Jersey zu betreten, wie seltsam und vielschichtig sie auch immer sein mochte – all das, kombiniert mit der Tatsache, dass dort auch mein Vater gewesen war und mein Name und mein Hintergrund etwas bedeuteten –, all das schien mir Ausweg und Erlösung zu versprechen und eine bessere Zukunft, als was sich mir zu Hause in New Orleans darbot.
Meine Mutter war auf die verglaste hintere Veranda gekommen. Auf dem manikürten Rasen hinter dem Haus standen, hübsch arrangiert, vier hölzerne Adirondack Chairs und ein hölzerner Picknicktisch, und zwar pink lackiert. Der Garten war komplett eingemauert, und nur unsere Nachbarn konnten – falls sie Wert darauf legten – sehen, dass William Dubinion ausgestreckt auf dem Picknicktisch in Pink lag, ohne Hemd, eine Zigarette rauchte und in den warmen blauen Himmel starrte.
Meine Mutter stand eine Weile da und betrachtete ihn. Sie trug einen Herrenpyjama aus weißer Seide, und ihre Stimme war belegt. Ich bin sicher, sie nahm damals schon die Drogen, die irgendwann ihren Verstand zerstörten. Sie hatte ein Glas Milch in der Hand, in dem wahrscheinlich nicht nur Milch war, sondern Milch mit Gin oder Scotch oder irgendetwas zur Linderung ihres fürchterlichen Zustands.
»Großartige Idee, mit deinem Vater jagen zu gehen«, sagte sie sarkastisch, als setzte sie damit ein früheres Gespräch zwischen uns fort, wo wir doch noch gar nichts darüber gesagt hatten, so gern ich es besprochen hätte und so sehr ich dachte, ich sollte gar nicht hingehen, und hoffte, sie würde es verbieten. »Besitzt du überhaupt eine Waffe?«, fragte sie, obwohl sie genau wusste, dass ich keine besaß. Sie wusste, was ich besaß und was nicht. Ich war fünfzehn.
»Er bringt mir eine mit«, sagte ich.
Sie warf mir einen Blick zu, wie ich da saß, aber ihr Gesichtsausdruck veränderte sich nicht. »Ich frag mich einfach, wie
Weitere Kostenlose Bücher