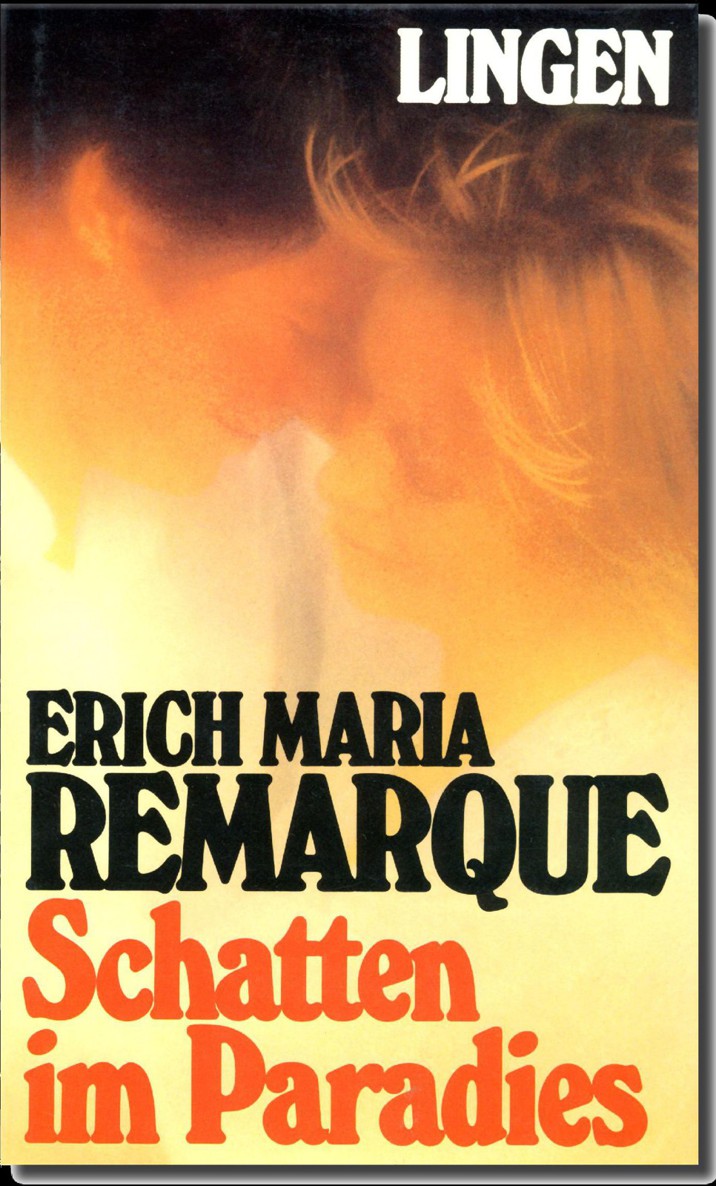![E.M. Remarque]()
E.M. Remarque
warten konnte. Ich schleppte das Gulasch und den Kuchen
hinauf. Dann ging ich noch einmal zur Zweiten Avenue, um Bier zu holen.
Ich hatte ein merkwürdiges Gefühl, als ich
mit dem Schlüssel die Tür öffnete und in die leere Wohnung trat. Ich konnte
mich nicht daran erinnern, daß ich das je irgendwann getan hatte. Immer war ich
entweder in ein Hotelzimmer gekommen oder zu Besuch in eine Wohnung. Jetzt
hatte ich das Gefühl, in meine eigene Wohnung heimzukehren. Ein sanfter Schauer
rieselte mir über die Arme, als ich die Tür aufschloß. Etwas aus weiter
Entfernung schien mich zu rufen, etwas, das mit meinem Elternhaus zu tun hatte
und woran ich lange Zeit nicht gedacht hatte. Die Wohnung war kühl, und ich
hörte das Summen der Klimaanlage im Fenster und des Eisschranks in der Küche.
Diese Geräusche waren wie freundliche Geister, die die Wohnung bewachten. Ich
drehte das Licht an, stellte das Bier kalt und das Gulasch auf den Gasherd mit
kleiner Flamme, um es warm zu halten. Dann schaltete ich das Licht wieder ab
und öffnete die Fenster. Die warme Luft kam wie ein Schwall herein, ungestüm
und begierig. Die kleine blaue Flamme auf dem Herd verbreitete ein schwaches
magisches Licht. Ich suchte mir im Radio die Station, die klassische Musik ohne
Reklame brachte. Gespielt wurden die Préludes von Debussy. Ich setzte mich in
einen Sessel am Fenster und sah auf die Stadt. Es war das erstemal, daß ich so
auf Natascha wartete. Ich war sehr ruhig und entspannt und genoß es sehr. Ich
hatte Natascha noch nichts davon gesagt, daß ich mit Silvers nach Kalifornien
fahren sollte.
Sie kam ungefähr eine Stunde später. Ich
hörte den Schlüssel in der Tür. Einen Augenblick dachte ich, der Besitzer der
Wohnung könnte unvermutet zurückgekommen sein, dann hörte ich Nataschas
Schritte. »Bist du da, Robert? Warum hast du kein Licht?«
Sie warf einen Koffer mit ihren Sachen in
das Zimmer. »Ich bin schmutzig und sehr hungrig. Was soll ich zuerst tun?«
»Baden. Und während du badest, kann ich dir
einen Teller Szegediner Gulasch reichen. Das Zeug steht heiß auf dem Gasherd.
Dazu gibt es Dillgurken und nachher Sachertorte.«
»Warst du wieder bei der fabelhaften
Köchin?«
»Ich war da und habe, wie eine Krähe für
ihr Junges, reichlich für uns mitgeschleppt. Wir brauchen zwei bis drei Tage
nichts einzukaufen.«
Natascha stieg bereits aus ihren Kleidern.
Das Badezimmer dampfte und roch nach Nelken von Mary Chess. Ich brachte das Gulasch.
Es war wieder einmal für einen Augenblick Frieden in der Welt. »Bist du heute
als Kaiserin Eugenie mit dem Diadem von van Cleef und Arpels photographiert
worden?« fragte ich, während sie das Gulasch beschnupperte.
»Nein. Als Anna Karenina. Pelze bis zum
Hals und auf dem Bahnhof von Petersburg oder Moskau wartend auf ihr Schicksal
in Gestalt von Wronski. Ich war erschreckt, als ich auf die Straße kam, und
kein Schnee war gefallen.«
»Du siehst aus wie Anna Karenina.«
»Immer noch?«
»Überhaupt.«
Sie lachte. »Jeder hat eine andere Anna
Karenina. Ich fürchte, sie war bedeutend dicker als die Frauen von heute.
Damals war das so Sitte. Das 19. Jahrhundert hatte ja doch Rubenssche Formate,
lange Korsetts, gepanzert mit Fischbeinstäbchen und Kleider bis auf den Boden.
Es kannte auch Badezimmer nur andeutungsweise. Was hast du alles hier gemacht?
Zeitungen gelesen?«
»Das Gegenteil! Mich bemüht, einmal nicht
an Schlagzeilen und Leitartikel zu denken.« – »Warum nicht?«
»Weil ich nichts dazu tun kann.«
»Das können die wenigsten. Abgesehen von
den Soldaten.«
»Ja«, sagte ich. »Abgesehen von den
Soldaten.«
Natascha gab mir den Teller zurück.
»Möchtest du einer werden?«
»Nein. Es würde nichts ändern.«
Sie beobachtete mich eine
Weitere Kostenlose Bücher