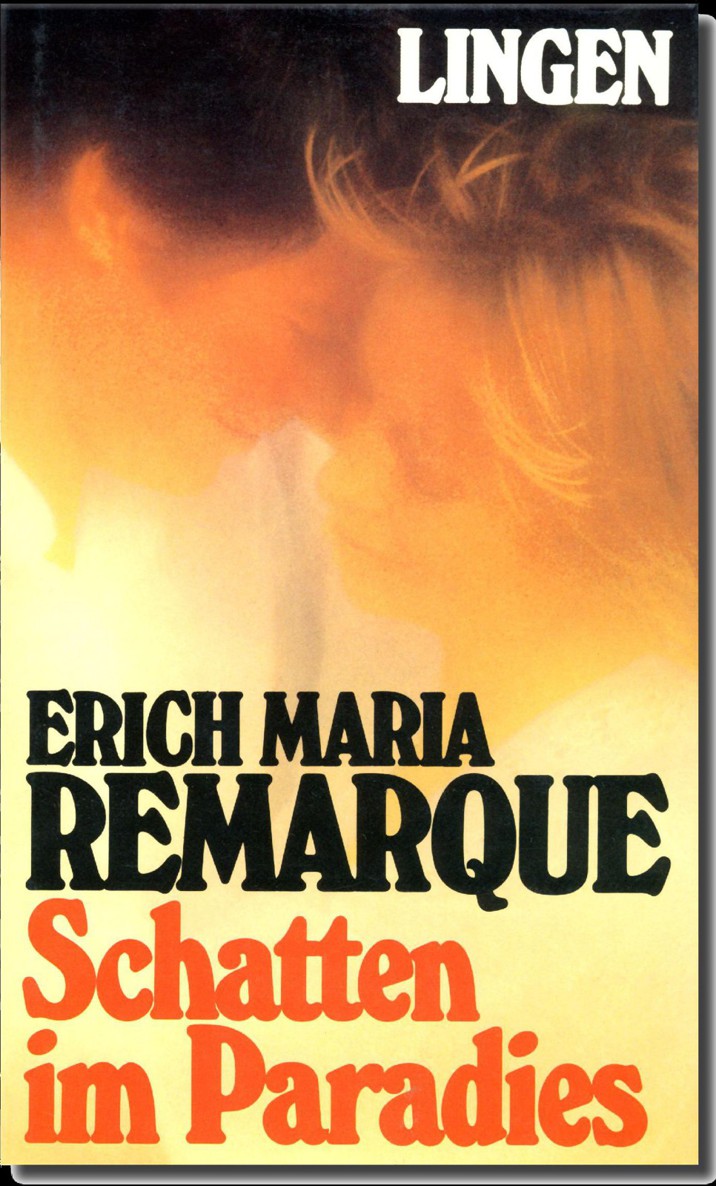![E.M. Remarque]()
E.M. Remarque
gekommen ist?«
»Herr Kahn«, sagte ich. »Amerika war das
Gelobte Land. Wir dachten damals nicht so weit über Gurs hinaus. Ich habe auch
keine Papiere mitgebracht.«
»Das macht nichts. Wir werden schon
irgendwas beschaffen. Die Hauptsache ist, daß Ihr Aufenthalt verlängert wird.
Sagen wir um einige Wochen. Oder Monate. Dazu brauchen wir einen Anwalt, weil
die Zeit so knapp ist. Wir kennen genügend Emigranten, die Anwälte waren. Betty
wird das besorgen. Aber was wir brauchen, ist ein amerikanischer Anwalt, wegen
der Zeit. Betty wird auch da Bescheid wissen. Haben Sie Geld?«
»Für zehn Tage.«
»Das brauchen Sie selbst. Wir müssen
aufbringen, was der Anwalt fordert. Es wird nicht sehr viel sein.«
Kahn lächelte. »Vorläufig halten die
Emigranten noch zusammen. Elend ist ein besserer Kitt als Glück.«
Ich sah Kahn an. Sein bleiches,
ausgemergeltes Gesicht wirkte sonderbar verschattet.
»Sie haben mir etwas voraus«, sagte ich.
»Daß Sie ein Jude sind. Nach dem jämmerlichen Programm dieser Leute drüben
gehören Sie nicht zu ihnen. Ich kann mich dieser Ehre nicht rühmen. Ich gehöre
zu ihnen.«
Kahn wandte sich mir zu. »Mein Volk?«
fragte er ironisch. »Sind Sie dessen sicher?« – »Sie nicht?«
Kahn betrachtete mich schweigend. Mir wurde
unbehaglich. »Ich rede Unsinn«, erklärte ich schließlich, um etwas zu sagen.
»Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, glaube ich.«
Kahn betrachtete mich immer noch. »Mein
Volk ...« sagte er dann und brach ab. »Auch ich fange an, Unsinn zu reden.
Kommen Sie! Machen wir etwas Unjüdisches und trinken wir zusammen eine Flasche
Schnaps.«
***
Ich wollte nicht
trinken, aber ich konnte auch nicht absagen. Kahn wirkte völlig gesammelt und
ruhig, doch ebenso ruhig hatte in Paris Josef Bär gewirkt, als ich zu müde war,
um mit ihm die Nacht durch zu trinken, und morgens hatte ich ihn erhängt in
seinem armseligen Hotelzimmer gefunden. Menschen ohne Wurzeln waren sehr labil,
und Zufälle spielten bei ihnen eine große Rolle. Hätte Stefan Zweig am Abend,
als er und seine Frau sich in Brasilien das Leben nahmen, mit jemand sprechen
oder wenigstens telefonieren können, es wäre vielleicht nicht geschehen. So saß
er in der Fremde unter Fremden und hatte außerdem noch den Fehler begangen,
seine Erinnerungen zu schreiben, anstatt sie zu meiden wie die Pest. Sie hatten
ihn überwältigt. Deshalb scheute auch ich vor ihnen zurück, solange ich nichts
tun konnte. Ich wußte, daß ich etwas tun mußte und wollte, und das lag wie ein
schwerer Stein in mir – aber dazu mußte der Krieg vorbei sein, und ich
mußte nach Europa zurückfahren.
Ich kam in das Hotel, das mir trostloser
erschien als früher. Ich setzte mich in die altmodische Halle, um auf Melikow
zu warten. Ich bemerkte niemand, bis ich glaubte, jemand schluchzen zu hören.
In einer Ecke, neben einem Ständer mit Blattpflanzen, saß eine Frau. Im
unsicheren Licht erkannte ich nach einer Weile Natascha Petrowna.
Sie wartete wahrscheinlich auch auf
Melikow. Das Weinen zerrte an meinen Nerven. Ich war vom Alkohol etwas benommen
und wartete noch eine kleine Weile, dann ging ich zu ihr hinüber.
»Kann ich etwas für Sie tun?« fragte ich.
Sie antwortete nicht. »Ist etwas passiert?«
fragte ich.
Sie schüttelte den Kopf. »Warum soll etwas
passiert sein?«
»Weil Sie weinen.«
»Muß deshalb etwas passiert sein?«
Ich starrte sie an. »Aber Sie müssen doch
einen Grund haben, wenn Sie weinen?«
»So?« fragte sie plötzlich feindlich.
Ich wäre gern weggegangen, aber mein Kopf
war nicht klar.
»Gewöhnlich hat man doch einen Grund«,
sagte ich schließlich.
»So? Kann man nicht ohne Grund weinen? Muß
alles immer einen Grund haben?«
Ich hätte mich nicht gewundert, wenn sie
erklärt
Weitere Kostenlose Bücher