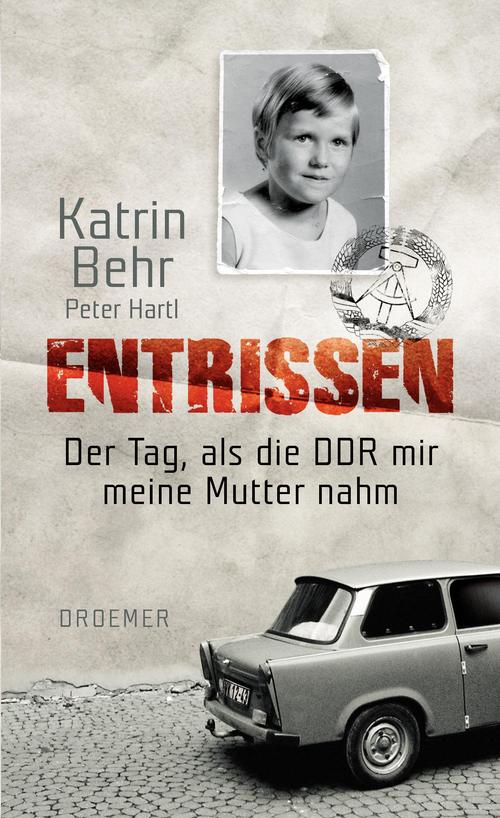![Entrissen]()
Entrissen
Kapitalismus hingestellt worden war: Im Mai 1991 wurde Olaf arbeitslos. Dank der monatlichen Überweisungen des Arbeitsamtes ließ es sich, entgegen der früheren Prophezeiungen der DDR -Propaganda, leidlich gut mit der Erwerbslosigkeit leben, bis mein Mann eine neue Stelle fand. Ich war beruhigt. Die neue Zeit war wohl doch nicht so erbarmungslos, wie ich insgeheim befürchtet hatte. Allerdings ereilte mich kurz darauf das gleiche Los: Meine Anstellung als Pflegerin in einem Altenheim, die ich nach Ablauf des Babyjahrs mit Benni in Berlin-Zehlendorf ergattert hatte, wurde nach der Probezeit im November 1991 nicht verlängert. Über ein Jahr lang war die Mutterrolle meine Hauptbeschäftigung, und mein Mann wurde wieder zum Haupternährer der Familie. Da unser kränklicher Sohn meine ungeteilte Zuwendung brauchte, kam mir das erzwungene Hausfrauendasein allerdings durchaus entgegen.
Persönlichen Halt gaben mir in dieser Zeit die Gespräche mit Olafs Schwester Kerstin, die im nahe gelegenen Stadtteil Neuenhagen lebte. Sie kannte ihren elf Jahre jüngeren Bruder nun wirklich von Geburt an aus der Nähe und flößte mir genügend Zutrauen ein, um meine Eheprobleme ansprechen zu können. Verlässlichkeit fand ich auch weiterhin bei meinem Vati, mit dem ich einen sporadischen Telefonkontakt hielt. Bei einem seiner seltenen Besuche in unserer Plattenbauwohnung im November 1992 versicherte er mir ohne Umschweife: »Katrin, wenn irgendetwas ist, ruf mich an. Ich komm sofort und hol dich mit den Kindern.« Es war ihm nicht entgangen, dass meine Ehe mit Olaf nur noch auf der Notwendigkeit gründete, durchzuhalten. Sowenig er sprach, er fand meist die richtigen Worte.
Mein Geraer Elternhaus stand indes unter keinem glücklichen Stern. Zu Ostern 1992 wurde bei meiner Adoptivmutter Magenkrebs diagnostiziert. Meiner Tochterpflicht gehorchend, besuchte ich sie in der Anfangszeit so oft wie möglich, um ihr angesichts der schockierenden Diagnose unterstützend zur Seite zu stehen. Es waren stets solche Momente des Leidens und der Not, die mir bewusst machten, wie sehr ich an dieser Frau hing, die es mir nie leicht gemacht hatte, sie zu lieben.
Kurz darauf, als sie sich bei einem Kuraufenthalt erholte, rief mein Adoptivvater an und berichtete von einem anhaltenden starken Husten. Ich riet ihm zum sofortigen Arztbesuch. Die medizinische Untersuchung ergab, dass er an Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium erkrankt war und maximal noch ein halbes Jahr zu leben hatte. Am Boden zerstört, erwog Vati den Freitod, stellte sich dann aber doch der hoffnungslosen Prognose. Seine Hauptsorge galt seiner Ehefrau. Ohne zu zögern, sicherte ich ihm zu, wie es meiner Erziehung entsprach, ihnen in diesen schwierigen Zeiten beizustehen.
Mich schmerzte am meisten die Vorstellung, dass der einzige Vater meines Lebens in absehbarer Zeit nicht mehr da sein würde. Übermächtig schob sich die Angst, erneut verlassen zu werden, in mein Bewusstsein. Es wurde ein Abschied auf Raten. Ein- bis zweimal im Monat fuhr ich nun nach Gera, um meinen Adoptiveltern zur Seite zu stehen. Nach gewohntem Muster war es meine Aufgabe, mich zu kümmern und zu helfen, wenn Not am Mann war. Oma Erna lebte nicht mehr, mein fünfzehnjähriger Adoptivbruder Sören hatte, während meiner Besuche gewöhnlich wie unsichtbar in seinem Zimmer verschanzt, mit seiner Pubertät zu kämpfen, und Mutti, ihrerseits gesundheitlich angeschlagen, war schnell überfordert, wenn es um zwischenmenschliche Anteilnahme ging.
Als ich im Sommer 1993 zu Besuch war, bestand Vati fast nur noch aus Haut und Knochen. Er hustete viel und litt unter starken Schmerzen. Mit dem Blick einer Krankenschwester erkannte ich auf Anhieb, dass ihm nur noch eine kurze Zeit beschieden war. Als Tochter schmerzte mich dieser Anblick bis an die Schwelle der Unerträglichkeit. Ungeachtet seiner Krankheit erteilte Vati mir als Führerscheinneuling Nachhilfe beim Autoanfahren am steilen Berg. Vorsorglich sammelte ich in meinem Klinikdienst Überstunden an, um über ausreichend freie Tage für die Zeit der Abschiednahme zu verfügen. Auf meiner Station begleitete ich in jenen Tagen bewusst einen Patienten in seinen letzten Stunden, um mich auf das vorzubereiten, was mir beim Sterben meines Vaters bevorstand.
Die Wirklichkeit an Vatis Sterbebett ließ alle meine beruflichen Erlebnisse verblassen. Im August von Mutti alarmiert, fand ich nur noch einen Schatten des einst vor Vitalität strotzenden Mannes vor. Vati
Weitere Kostenlose Bücher