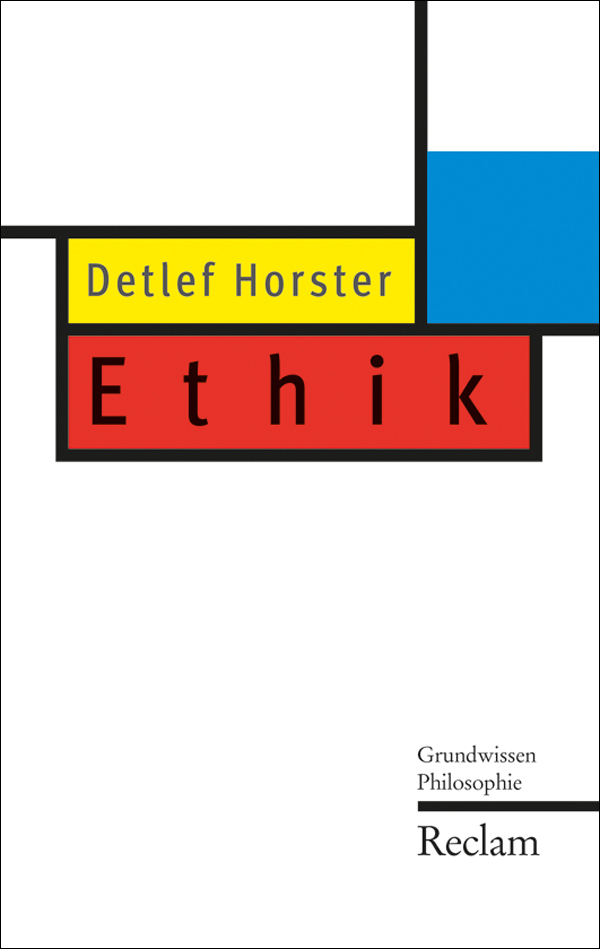![Ethik: Grundwissen Philosophie]()
Ethik: Grundwissen Philosophie
darüber einigen, wohin sie gehen wollen, und jeder von beiden versucht, die Einstellung des anderen in seine Richtung zu lenken. […] In der Ethik handelt es sich um Divergenz in den Einstellungen. Wenn C sagt, ›Dies ist gut‹ und D sagt, ›Nein, es ist schlecht‹, so haben wir einen Fall von Suggestion und Gegen-Suggestion.« (Stevenson 1974, 132) Nun kommen die deskriptiven Elemente ins Spiel, die bei der Abstützung moralischer Überzeugungen in analoger Weise auch ins Spiel kämen: »A könnte sagen, ›Aber hör mal, im Eldorado läuft ein Film mit der Garbo‹. Er hofft, daß B – ein Bewunderer der Garbo – den Wunsch bekommt, ins Kino zu gehen, wenn er weiß, was dort für ein Film läuft. B könnte entgegnen, ›Aber Toscanini ist der Gastdirigent beim heutigen Beethoven-Abend‹. Und so weiter. Jeder stützt seinen Imperativ (›Komm, wir machen das und das‹) mit Gründen, die empirisch fundiert sein können.« (Stevenson 1974, 133) Ethische Ausdrücke sind nach Stevenson nichts anderes als soziale [105] Instrumente, womit man andere von der eigenen Auffassung zu überzeugen sucht. (Vgl. Stevenson 1974, 123 und 137) Dazu bringe man dann auch deskriptive Argumente ins Spiel, etwa: »Deinem Freund geht es dann besser, wenn du ihm bei der Steuererklärung hilfst, und für dich ist es nur ein geringer Verzicht, nicht zum Europapokalspiel zu gehen.«
Die Überzeugungsarbeit – und darin ist sich Stevenson mit Ayer einig – fällt umso leichter, als die Protagonisten derselben sozialen Gemeinschaft angehören: »Daß in einer Gemeinschaft eine größere Ähnlichkeit der moralischen Einstellungen vorliegt, als dies in verschiedenen Gemeinschaften der Fall ist, liegt weitgehend an folgendem: Moralurteile pflanzen sich selbst fort. Einer sagt ›Dies ist gut‹; das mag jemand anderen beeinflussen, es wertzuschätzen; dieser äußert nun dasselbe Moralurteil, welches wiederum eine andere Person beeinflußt, und so weiter. […] Zwischen Mitgliedern weit voneinander entfernter Gemeinschaften ist dieser Einfluß natürlich weniger stark; daher haben verschiedene Gemeinschaften verschiedene Einstellungen.« (Stevenson 1974, 124) Stevenson stellt also auf die soziale Basierung und Eingebundenheit der Moral ab. Moralische Urteile sind für ihn allerdings noch von weiteren Elementen abhängig: von den individuellen Überzeugungen, von individuellen Präferenzen, vom Habitus und von der sozialen Stellung, die derjenige hat, der ein moralisches Urteil äußert. Wenn sich zum Beispiel jemand zur Frage der Arbeitslosenunterstützung äußere, hänge sein Urteil stark davon ab, ob »A arm und arbeitslos und B reich« sei. (Stevenson 1974, 134)
Die Gegenposition zur nonkognitivistischen von Alfred Jules Ayer und Charles Leslie Stevenson vertritt Hilary Putnam. (Vgl. Putnam 1982, 179ff.) Dass dem naturwissenschaftlichen Wissen Objektivität bescheinigt würde, dem moralischen aber nicht, beruht nach seiner Ansicht auf einem Irrtum darüber, was Objektivität bedeutet. Putnam (*1926) sieht keinen Unterschied zwischen der Erkenntnis [106] deskriptiven und normativen Wissens. Wissenschaftliches Wissen ist für ihn ebenfalls »intrinsisch normativ« (Ernst 2008, 223). Auch andere Philosophen, wie neuerdings Gerhard Ernst, verfolgen die Strategie, die Objektivität moralischen Wissens nachzuweisen, indem sie die »Analogie zwischen moralischer und wissenschaftlicher Erkenntnis« aufzeigen. (Ernst 2008, 212) Putnam argumentiert in folgender Weise:
– Die Wissenschaftler wollen ein Weltbild konstruieren, das die Kriterien rationaler Akzeptierbarkeit erfüllt. Die Wahrheit, die das Ziel einer jeden wissenschaftlichen Bemühung ist, empfängt ihr Leben erst durch die Kriterien rationaler Akzeptierbarkeit.
– Woher aber wissen wir, dass eine Aussage wahr ist? Putnams Antwort lautet: Sie ist dann wahr, wenn wir innerhalb einer wissenschaftlichen Theorie eine Erklärung darüber abgeben können, wie sich aus dem Wechselspiel von Sinnesorganen und Außenwelt Wahrnehmungen ergeben, denn in der Wissenschaft geht es um den Versuch, eine Repräsentation der Welt zu konstruieren. Oder anders formuliert: Es geht jedem Wissenschaftler darum, ein wahres Bild der Welt zu erzeugen.
– Dies gelingt nur, wenn man sich von den Kriterien der rationalen Akzeptierbarkeit leiten lässt. Diese sind: Kohärenz, Komplettheit, funktionale Einfachheit und instrumentelle Effizienz. Das sind nach Putnam die Werte der Wissenschaft. Die
Weitere Kostenlose Bücher