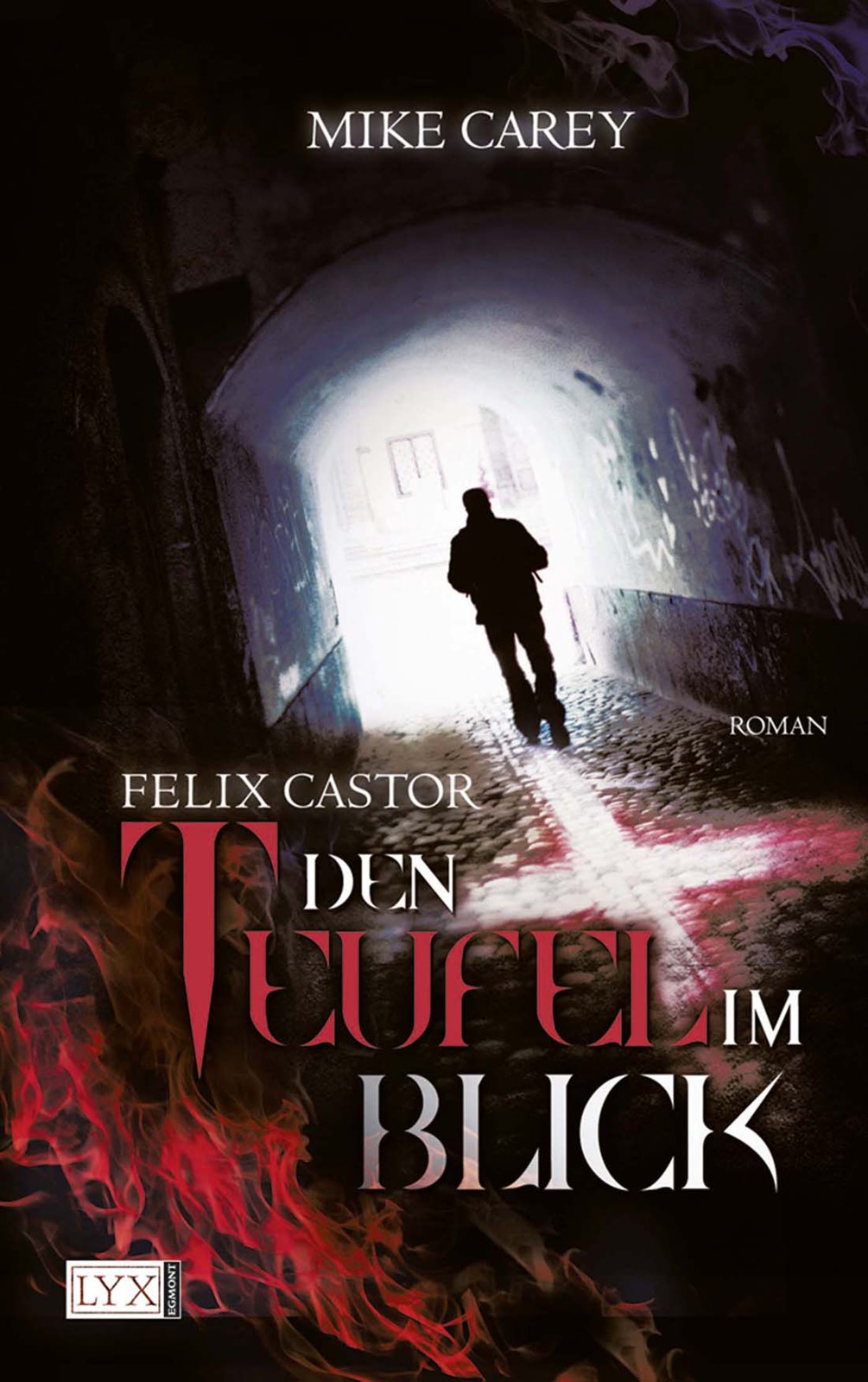![Felix Castor (01) - Den Teufel im Blick]()
Felix Castor (01) - Den Teufel im Blick
ich einen genaueren Blick auf die Kette und erkannte ihren Rosenkranz.
»Pen«, sagte ich, denn ich konnte unmöglich nicht nachfragen, »was tust du da?«
»Ich feile die Perlen kleiner«, entgegnete sie schlicht.
»Weil …?«
»Sie waren zu groß.« Sie sah mich jetzt an, wobei sie den Kopf drehte und ins Licht blinzelte. »Du hast dich umgezogen«, stellte sie enttäuscht fest. »Ich hatte gehofft, du kämst im Anzug zurück.«
»Er liegt im Auto«, sagte ich und stellte Rhonas Käfig auf den Tisch. »Danke für die Leihgabe!«
Sie schürzte die Lippen und erzeugte Kussgeräusche in Rhonas Richtung. Die Ratte richtete sich auf und kratzte an den Käfigstäben.
»Würdest du sie in den Harem zurückbringen?«, bat Pen.
Nur zu gerne. Die Alternative wäre gewesen, sie über die Party aufzuklären, dort und gleich, und jede Minute, die ich diesen Dialog hinauszögern konnte, war eine Minute Glückseligkeit. Aber die Perlen hatten sich in meinem Kopf festgesetzt. Vielleicht, weil ich gerade eben bei Rafi gewesen war, und dies sah aus wie etwas, womit die Insassen von Stanger sich in den Stunden zwischen ihren Elektroschocksitzungen beschäftigten.
»Zu groß wofür?«, fragte ich
Pen gab keine Antwort. »Bring Rhona runter«, sagte sie. »Ich komme gleich. Übrigens habe ich etwas gefunden, was dir gehört – es liegt neben der Uhr auf dem Kaminsims.«
Während ich die Treppe in Pens Kellerzitadelle hinabstieg, hörte ich plötzlich etwas, das in mir eine Welle des Unbehagens hochschäumen ließ. »Enola Gay« von OMD. Pen ließ oft ihre alten Schallplatten auf dem Plattenspieler laufen, wenn sie den Raum verließ, und der Plattenspieler kehrte nach Ende der Platte immer wieder an den Anfang zurück. Aber sie spielte Sachen aus den Achtzigern, und das war kein gutes Zeichen. Die Tür zu ihrem Wohnzimmer stand offen. Edgar und Arthur musterten mich traurig von ihren Lieblingsplätzen aus – dem Bücherschrank beziehungsweise einer verblichenen John-Lennon-Büste –, während ich Rhona von dem Transportkäfig in das große Rattenpenthouse umsetzte, wo sie mit einer Gefolgschaft großer, kräftiger männlicher Ratten lebte, die sich schon darauf freuten, ihr das zu geben, was ich ihr so eklatant verweigert hatte.
Ich sah zum Kaminsims. Dort lehnte etwas an Pens absonderlicher antiker Standuhr: eine halb zusammengerollte glänzende Karte, grauweiß auf der Seite, die mir zugewandt war. Ein Foto. Ich durchquerte den Raum, nahm es und drehte es um.
Ich ahnte schon, was es sein würde – die Musik und Pens Laune hatten schon vorzeitig einige Leerstellen ausgefüllt. Aber es traf mich dennoch wie ein Schlag in die Magengrube.
Der Hof von St. Peter’s in Oxford – wo der Springbrunnen stand, in dem oft andere Dinge als Wasser flossen. Nacht. Eine Szene, eingefangen von dem unheilvollen Auge eines Blitzlichts, daher war kein nennenswerter Hintergrund zu erkennen. Nur Felix Castor, neunzehn Jahre alt, mit brünetten Locken und einem angestrengten Grinsen, der sich krampfhaft bemühte, nicht so auszusehen, als hätte er erst acht Monate zuvor eine staatliche Gesamtschule abgeschlossen. Ich trug bereits einen langen Mantel, aber damals war es noch ein tuntiger schwarzer Burberry. Ich hatte mich noch nicht der vorrevolutionären russischen Armee angeschlossen, und da der Mantel für jemanden geschneidert war, der um einiges breitere Schultern hatte, sah ich aus wie hundertfünfundsiebzig Zentimeter süßer Fanny Adams.
Zu meiner Linken Pen. Gott, war sie hübsch! Es gab kein Foto, das ihren Farben, ihrer Aufgewecktheit und Lebhaftigkeit gerecht wurde. Mit dem federverzierten Snood, einem mit rotem Strass besetzten Top und einem geschlitzten schwarzen Rock (der anzeigte, dass dies der Morgen nach einer Party war) sah sie aus wie eine Nutte, die alles darangesetzt hatte, Nonne zu werden, es jedoch bisher noch niemandem verraten hatte. Ihre Hand war zum Himmel erhoben, der Zeigefinger ausgestreckt.
Rechts von mir Rafi. Er trug eine dunkle Nehru-Jacke und -Hose, die sein Markenzeichen waren, und er lächelte wie jemand, der ein großes Geheimnis mit sich herumträgt. Herman Melville sagte einmal, das sei ein einfacher Trick. Aber der glaubte auch, Moby-Dick sei ein Wal.
Rafi und ich kauerten am Boden, jeder ein Bein nach hinten gestreckt, das andere in einer Kniebeuge. Ich erinnerte mich an diese Nacht mit einer Deutlichkeit, die nie nachgelassen hatte, und kannte den Grund für diese seltsame Pose. Wir waren in
Weitere Kostenlose Bücher