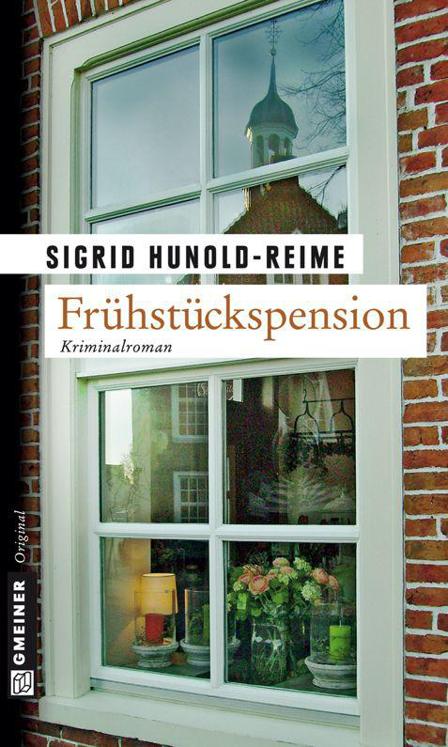![Frühstückspension: Kriminalroman]()
Frühstückspension: Kriminalroman
unter Druck zu setzen und eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Dann würde es schon klappen. Als Scheidungsgrund hätte sie das nie akzeptiert.«
»Aber du hast es ihr nicht erzählt, also weißt du auch nicht, wie sie reagiert hätte«, werfe ich ein.
Tomke sieht mich schief an.
»Darin sind wir beide uns dann wohl sehr ähnlich. Oder hast du mit deiner Mutter jemals über Reinhard gesprochen?«
Ich zucke schuldbewusst mit den Schultern.
»Nein, weil ich ihr den Triumph nicht gönnte. Aber das ist jetzt sowieso unwichtig. Du weißt nicht, wie deine Mutter damit umgegangen wäre, und ich weiß das von meiner auch nicht.«
Tomke nickt und erzählt weiter.
»Nach Weihnachten kaufte ich mir den größten Teddy meiner Sammlung. Den, der im Fernsehzimmer sitzt. Er hatte so ein liebes Gesicht.
Zum Jahreswechsel brachte Gerold mir einen mit. Ich wertete das als Entgegenkommen und schöpfte noch einmal Hoffnung.
Ich habe liebevoll den Tisch gedeckt, Gerolds Lieblingsessen gekocht und auf ihn gewartet.
Das war übrigens nichts Ungewöhnliches. Ich habe mir meistens viel Zeit zum Kochen genommen. Das hat mir Freude gemacht und auch Halt gegeben.
Ich habe immer zusammen mit Gerold gegessen – und so getan, als wäre alles in Ordnung. Aber an dem Tag habe ich das Tabu gebrochen und gesagt: ›Ich muss mit dir über uns reden.‹
Gerolds Gesicht verschloss sich sofort. Ich sollte ruhig sein. Aber ich wollte nicht ruhig sein. Ich wollte es noch einmal versuchen.
›Gerold, was stimmt mit uns nicht? Warum können wir nicht miteinander schlafen?‹
Eisiges Schweigen. Er hat konzentriert die Kartoffeln zerlegt, auf die Gabel gespießt, in Soße getunkt und in den Mund geschoben. Das hat mich rasend gemacht. Warum tat er so, als hätte er mich nicht verstanden? Warum ignorierte er mein Gesprächsangebot? Es war mir schwer genug gefallen. Warum behandelte er mich, als würde mit mir etwas nicht stimmen? Anscheinend hatte er doch ein Problem.
›Willst du nicht mal zu einem Facharzt gehen?‹
Da war es heraus. Direkter, als ich es gewollt hatte. Gerolds Gesicht lief rot an. Er fixierte mich mit seinen Augen wie ein lästiges Insekt, nur kurz. Dann griff er seinen Teller und schleuderte ihn gegen die Wand. Es folgte die Schüssel mit Gulasch. Danach stand er wortlos auf und verließ das Haus. Ich blieb wie versteinert am Tisch sitzen und starrte auf die träge von der Tapete tropfende Soße.
Am nächsten Morgen tat er, als wäre nichts geschehen. Er war freundlich und zuvorkommend, und am Abend brachte er mir einen wunderschönen Strauß Frühlingsblumen mit. Jeder, der uns sah, musste glauben, wir wären ein glückliches junges Ehepaar. Es war unerträglich.
Ich bin verzweifelt zu meinem besten Freund gefahren. Thomas. Das erste Mal, seit ich verheiratet war. Ich war ihm aus dem Weg gegangen, weil ich ihm noch nie was vormachen konnte. Er war zwei Jahre älter als ich und wohnte in Carolinensiel. Dort sollte er die Gastwirtschaft von seinem Onkel übernehmen. Wir setzten uns an den Deich und sahen auf das Meer. Lange Zeit. Dann konnte ich endlich reden. Schonungslos. Es tat so gut, von ihm in den Armen gehalten zu werden. Ich konnte mich endlich richtig ausheulen.
Mehr passierte nicht. Wir waren seit der Grundschulzeit Freunde. Und das wollten wir auch bleiben. Zwischen uns war eine tiefe Zuneigung. Von Anfang an. Außerdem ging Thomas zu der Zeit schon fest mit Heike.
›Du kannst dich scheiden lassen‹, sagte er liebevoll.
›Super Idee!‹, fauchte ich ihn an. ›Du kennst meine Eltern und alle anderen hier auch. Sie werden es nie verstehen. Ganz davon abgesehen, wie soll ich meinen Scheidungsgrund formulieren? Dass ich noch Jungfrau bin?
Dann muss ich auswandern. Aber ich möchte hier wohnen bleiben.’
Thomas schwieg betroffen, weil er wusste, dass ich recht hatte.
›Vielleicht solltest du eine Ausbildung machen. Du arbeitest doch manchmal bei diesem Rechtsanwalt. Vielleicht findet sich dann alles Weitere.‹
›Du redest wie mein Vater!‹, fuhr ich ihn an. ›Was soll sich finden? Es findet sich nichts von allein!‹
Dr. Henkel hätte mich als Lehrling angenommen. Da war ich sicher. Aber ich wollte mich nicht ablenken. Ich wollte das Problem lösen. Ich wollte eine normale Ehe führen. Eine Familie haben.
›Dann adoptiert doch ein Kind‹, schlug Thomas vor.
Ich wollte schon wieder hochfahren und sagen, dass dieser Vorschlag genauso blöde war wie sein anderer, da kam mir eine Idee. Ein Kind,
Weitere Kostenlose Bücher