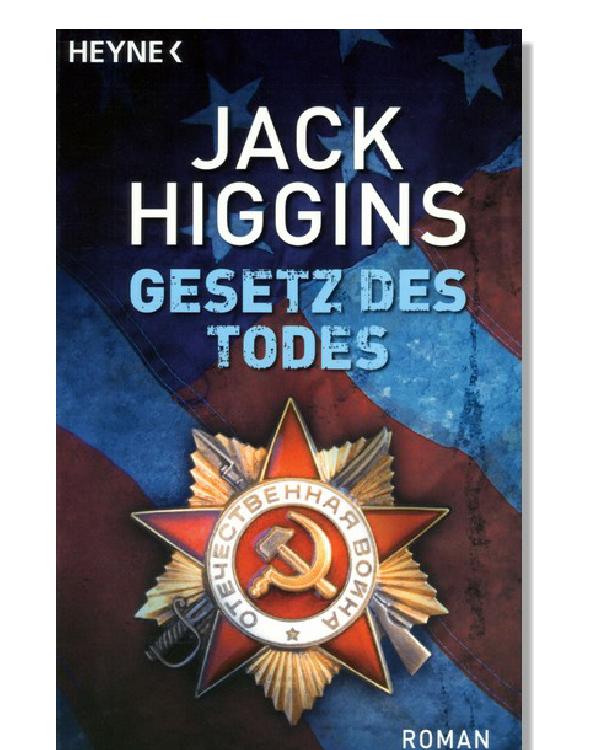![Gesetz des Todes]()
Gesetz des Todes
nachmittags parkte Dillon seinen Mini Cooper vor dem Rosedene. Auf dem Weg zum Empfang sah er Professor Henry Bellamy aus seinem Büro kommen.
»Hallo, Sean. Hannah wurde gerade wieder hierher zurückverlegt, aber das wissen Sie ja bereits. Geben Sie ihr noch ein bisschen Zeit, sich einzugewöhnen.«
»Wie geht es ihr?« Dillon war kreidebleich im Gesicht.
»Was für eine Antwort erwarten Sie von mir? Den Umständen entsprechend?«
In diesem Moment kam Rabbi Julian Bernstein, Hannahs Großvater, aus der kleinen Cafeteria. Mit einem gütigen Lächeln legte er Dillon beide Hände auf die Schultern.
»Sean, Sie sehen hundeelend aus.«
Bellamy ließ die beiden allein, als Dillon dem Rabbi entgegnete: »Sie müssen dieses Leben hassen, das Hannah führt. Das habe ich schon einmal zu Ihnen gesagt. Sie müssen uns alle hassen.«
»Mein lieber Junge, Hannah führt genau das Leben, für das sie sich entschieden hat. Ich bin ein praktisch veranlagter Mensch. Wir Juden müssen das sein. Ich akzeptiere, dass es Menschen gibt, die einen Job gewählt haben, an dem sich die anderen Mitglieder der Gesellschaft, nun … nicht die Finger schmutzig machen wollen.«
»Haben Sie sie gesehen?«
»Ja. Sie ist sehr müde, aber ich glaube, Sie können ihr kurz guten Tag sagen und dann wieder verschwinden. Zimmer zehn.«
Er klopfte Dillon väterlich auf die Schulter und ging seines Weges. Dillon stieß die Schwingtüren zum hinteren Teil des Flurs auf.
Als er in Hannahs Zimmer trat, zog Oberschwester Maggie Duncan soeben die Vorhänge zu. Sie drehte sich um und ging auf ihn zu. Ihre Stimme klang ein bisschen nach schottischem Hochland.
»Da sind Sie ja schon wieder, Sean. Was mache ich nur mit Ihnen?« Sie tätschelte ihm die Wange. »Gott allein weiß, wie oft ich Sie im Laufe der Jahre schon zusammengeflickt habe.«
»Diesmal können mir Nadel und Faden nicht helfen, Maggie. Wie geht es ihr?«
Sie drehten sich beide zu Hannah Bernstein um, die mit einem scheinbar endlosen Netzwerk von Schläuchen verbunden war, die zu einem Beatmungsgerät und diversen anderen elektronischen Apparaten und Monitoren führten. Ihre Augen waren geschlossen, die Lider nahezu durchscheinend.
»Sie ist sehr schwach«, sagte Maggie mit leiser Stimme. »Ihr Herz ist großen Belastungen ausgesetzt.«
»Das überrascht mich nicht. Wir haben zu viel von ihr verlangt, wir alle. Besonders ich«, sagte Dillon.
»Als sie letztes Jahr hier lag, nachdem dieser Gotteskrieger sie angeschossen hatte, haben wir beide lange Gespräche geführt, und dabei ging es hauptsächlich um Sie. Hannah hat Sie sehr gern, Sean. Okay, zugeben würde sie das natürlich nie, aber so ist es.«
»Ich würde es gerne glauben«, erwiderte Dillon. »Aber verdient habe ich es nicht.«
Mühsam schlug Hannah die Augen auf und sagte leise: »Was ist denn, Sean? Tut er sich leid, der stahlharte IRA-Mann?«
»Verdammt leid, ja«, gab er zurück. »Du hast mich das Fürchten gelehrt.«
»Ach du Schande. Jetzt habe ich schon wieder was falsch gemacht.«
»Zwei Minuten, Sean, dann komme ich Sie holen«, mahnte ihn Maggie.
Sie verließ das Zimmer und zog leise die Tür hinter sich zu. Dillon blieb am Fußende des Betts stehen. »Mea culpa.«
»Nur zu, mach dir nur weiter Vorwürfe. Das ist lediglich eine Art von Rechtfertigung, nein, schlimmer noch, all zu große Nachsicht nenne ich das. Ist das eine Eigenheit der Iren?«
»Der Teufel soll dich holen!«, zischte Dillon.
»Nein, dich soll er holen, obwohl dafür schon gesorgt ist.« Sie verzog das Gesicht. »Was für schreckliche Worte. Wie konnte ich nur?« Sie streckte eine schmale weiße Hand nach ihm aus, die er sogleich umfasste, und Hannah drückte die seine mit erstaunlicher Kraft. »Du bist ein guter Mensch, Sean, ein guter Mensch, trotz allem. Das habe ich immer gewusst.«
Ihre Hand wurde schlaff, und Dillon, den seine aufwallenden Gefühle beinahe erstickten, ließ sie behutsam los. Hannahs Augen waren wieder geschlossen, und als sie sprach, war ihre Stimme nur noch ein Hauch.
»Die Nacht ist ein Segen, Sean.«
Dillon schaffte es hinaus auf den Korridor, wo er sich erst einmal an die Wand lehnte und tief durchatmete. Eine junge Krankenschwester, die einen Medikamentenwagen vor sich her schob, kam ihm entgegen, blieb vor Hannahs Tür stehen und musterte ihn mit gerunzelter Stirn. Sie war ausnehmend hübsch, hohe Wangenknochen, dunkle Augen.
»Geht es Ihnen gut?«
Sie sprach mit dem typischen Dublin-Akzent. Er nickte.
Weitere Kostenlose Bücher