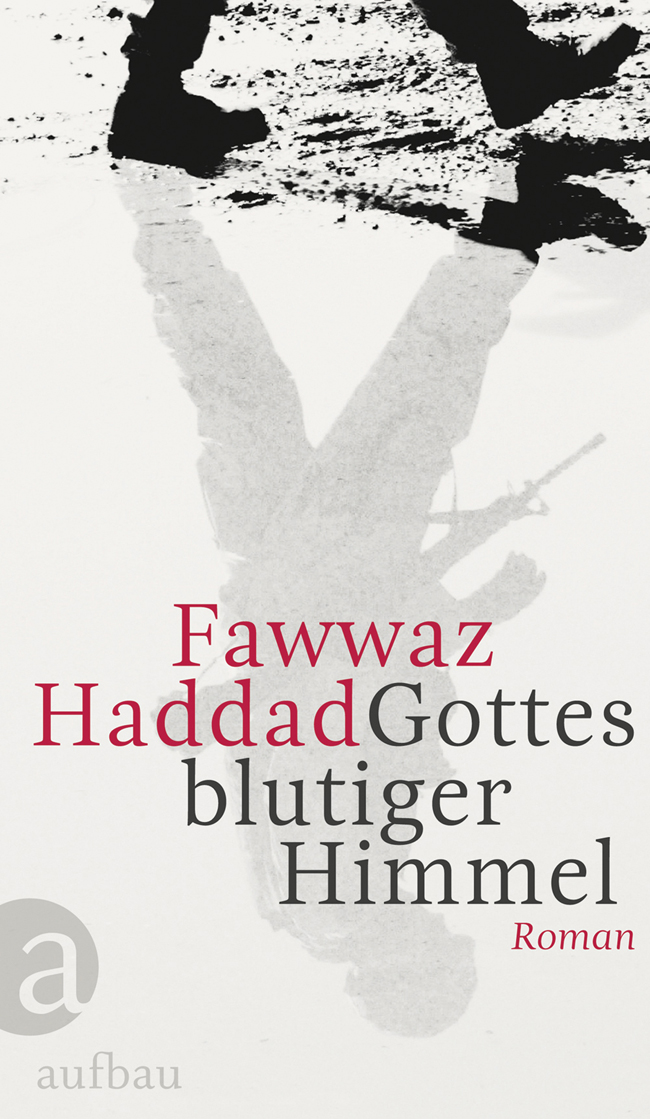![Gottes blutiger Himmel]()
Gottes blutiger Himmel
nur eine Vermisstenanzeige für ihre Söhne aufgeben.«
Als Salman erfuhr, dass ich Syrer war, fasste er Vertrauen zu mir und setzte sich neben mich. Wir kamen ins Gespräch, und ich erzählte ihm, dass ich meinen Sohn suche. Er klagte mir, dass er sich nicht gerne verstecke. Ihn tröste nur, dass er nach der Flucht in Gesellschaft seines Freundes sein würde. Ich sagte: »Es ist besser, wenn du dich versteckst. Damit ersparst du deinen Eltern viel Kummer. Sie sind wahrscheinlich nicht sehr glücklich über deine Eigenart.«
»Im Gegenteil«, korrigierte er mich. »Meine Eltern und meine Geschwister machen sich Sorgen um mich.«
Ich war überrascht, weil ich erwartet hatte, die Familien wären erleichtert, ihre so gearteten Söhne loszuwerden.
»Meine Geschwister wollen nicht, dass ich weggehe. Und meine Eltern nehmen ihre Kinder so an, wie Gott sie ihnengegeben hat. Sie glauben, dass sie selbst Schuld daran haben, wie ich bin. Mein Vater wollte einen Jungen, meine Mutter ein Mädchen. Möge Gott ihnen vergeben. Während mich mein Vater immer als Jungen behandelt hat, hat meine Mutter mich so erzogen, als sei ich ein Mädchen.«
Ich schwieg, und er erriet, woran ich dachte. Traurig fragte er mich: »Stellen Sie sich vor, ich wäre Ihr Sohn. Was würden Sie tun? Würden Sie sich von mir lossagen?« Ich überlegte nur kurz und sagte: »Wegen meines Sohnes bin ich in den Irak gekommen.«
Zum ersten Mal machten uns Panzerfahrzeuge und Soldaten Hoffnung. Sie würden die jungen Schwulen retten. Zuvor hatte ich mir nur ein schreckliches Ende für sie vorstellen können.
Mit der so gewonnenen Hoffnung widmete ich mich gegen Morgen wieder meiner Idee. Ich zögerte zwar noch ein wenig, aber mein Entschluss stand fest. Gleich würde ich wieder meinen Freund von der Baath-Partei treffen, und als Fadhil kam, um mich zu ihm zu bringen, eröffnete ich ihm, was ich mir in den Kopf gesetzt hatte: »Ich werde mich dem Parteimann als Geisel anbieten. Er soll mich an irgendeine Gruppierung weitergeben, die meine Entführung dann für sich beanspruchen kann. Dabei würde al-Qaida keinen Hinterhalt der Amerikaner vermuten«
Fadhil war in schlechter Stimmung und überhaupt nicht begeistert von meiner Idee. Als ich versuchte, sie ihm auseinanderzusetzen, schrie er mich plötzlich an: »Sie sind wohl verrückt! Sie wollen sich Verbrechern und Mördern ausliefern, damit sie Sie verhökern?« Dann schwieg er. Er hatte gemerkt, dass er mir zu nahe getreten war. Seine Miene war verspannt und sein Blick unruhig. Ich spürte, dass er etwas sagen wollte, es aber nicht herausbrachte. Offensichtlich war er so aufgebraust, weil ihn etwas bedrückte. »Rabiawurde ermordet!«, presste er schließlich hervor. Ich begriff nicht. Erst zwei Tage zuvor hatte sein Vater ihn doch bei Fadhil abgeholt, nachdem die Familie der beiden Getöteten sich bereit erklärt hatte, ein Blutgeld anzunehmen. Betroffen fragte ich nach einer Erklärung und hörte Fadhil sagen: »Sein Vater hat ihn getötet.« Ich glaubte mich verhört zu haben. Eher hatte ich angenommen, dass die Verwandten der Opfer ihn entgegen der Absprache ermordet hätten.
Aber ich hatte richtig gehört. Rabias Vater hatte gelogen. Es gab keine Absprache über ein Blutgeld, die Angehörigen der Toten wollten Blutrache. Rabias Vater machte zur Bedingung, sie selbst auszuführen. Und so, wie er seinen Sohn aus Fadhils Wohnung gelockt hatte, lockte er ihn im Dorf auf die Felder. Er brachte es nicht übers Herz, ihm die Wahrheit zu sagen, und fürchtete außerdem, Rabia würde weinen und ihn um Gnade anflehen, so dass er ihn aus Mitleid am Leben lassen würde. Er bat daher seinen Sohn vorauszugehen und lief hinter ihm her. Stroh raschelte unter ihren Füßen, und Schweiß tropfte ihnen von der Stirn. Die Bäume und Pflanzen waren fahlgelb. Rabia ging einen Hügel hinauf, und nun gab der Vater von hinten mit zitternder Hand und Tränen in den Augen einen Schuss auf seinen Sohn ab. Rabia, von der Kugel getroffen, blickte zu ihm. Er dachte, jemand schösse auf sie beide, und stürzte zu seinem Vater, um ihn zu schützen. Doch nun sah er, wie dieser, einen Klagelaut ausstoßend, ein zweites Mal auf ihn schoss. Rabia fiel tot auf fahlgelbe Erde, sein Vater warf sich neben ihm auf die Knie, umarmte ihn und weinte. Dann hüllte er ihn, blutig, wie er war, in ein Leichentuch und trug ihn zum Dorfplatz. Tags darauf sprach er für seinen Sohn das Totengebet und begrub ihn, ohne Beileidsbekundungen
Weitere Kostenlose Bücher