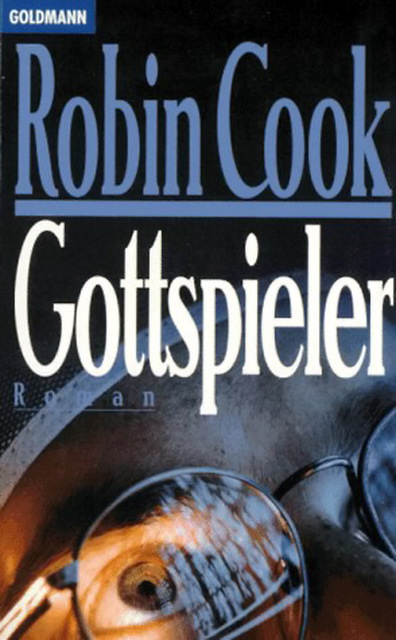![Gottspieler]()
Gottspieler
Notizen durchging. Es war ihr nicht entgangen, wie geschickt er Mr. Lowell behandelt hatte. Nie schien er zu zögern. Er wußte, was getan werden mußte, und tat es. Von jeher hatte sie seine Fassung bewundert, eine Eigenschaft, die ihr völlig abging, wie sie fand. Sie lächelte, als ihre Augen die scharfen Konturen seines Profils nachzeichneten, über sein sandfarbenes Haar strichen und seinen athletischen Körper verschlangen. Sie fand ihn außergewöhnlich attraktiv.
Nach den Fährnissen des Tages oder, genauer, der ganzen Woche wäre sie am liebsten auf ihn zugestürzt, um sich an ihn zu schmiegen, aber sie spürte instinktiv, daß er von einem solchen Gefühlsausbruch jetzt nicht gerade begeistert wäre, schon gar nicht in Anwesenheit von Doris. Und sie wußte, daß er recht hatte. Das Büro war für ein derartiges Verhalten nicht der geeignete Ort. Statt dessen schob sie die Berichte wieder in die Mappe und die Mappe zurück in die Leinentasche.
Thomas beendete seine Instruktionen, wartete aber noch, bis sich die Tür des Sprechzimmers hinter ihnen geschlossen hatte, ehe er sich ihr zuwandte.
»Ich muß noch auf die Intensivstation«, sagte er ausdruckslos. »Du kannst mich begleiten oder im Foyer warten, das überlasse ich dir. Es wird nicht lange dauern.«
»Ich begleite dich«, sagte Cassi. Sie merkte bereits, daß er keinen leichten Tag gehabt hatte, und ging etwas schneller, um mit ihm Schritt zu halten.
»Gab es Schwierigkeiten bei den Operationen heute?« fragte sie vorsichtig.
»Nicht die geringsten.«
Cassi beschloß, nicht weiter in ihn zu dringen. Es war ohnehin schwierig, sich miteinander zu unterhalten, während sie sich zum Scherington-Gebäude durchschlängelten. Davon abgesehen wußte sie aus Erfahrung, daß es besser war, wenn Thomas von sich aus zu erzählen begann, vor allem, wenn ihn etwas aufgeregt hatte.
Im Fahrstuhl hielt er seine Augen unverwandt auf die Stockwerkanzeige gerichtet. Er wirkte verkrampft und geistesabwesend.
»Ich freue mich schon darauf, wenn wir heute abend zu Hause sind«, sagte Cassi. »Endlich mal wieder ausschlafen.«
»Deine Verrückten haben dich letzte Nacht wohl nicht zur Ruhe kommen lassen?«
»Bitte, Thomas, fang jetzt bloß nicht mit deinen Chirurgenansichten über Psychiatrie an«, sagte Cassi.
Er antwortete nicht, dafür geisterte ein ironisches Lächeln über sein Gesicht, und er schien sich etwas zu entspannen.
Im siebzehnten Stock stiegen sie aus. Trotz all der Jahre, die Cassi bereits in Krankenhäusern verbracht hatte, spürte sie immer wieder das gleiche Unbehagen, wenn sie über den Operationsflur ging. Es war nicht direkt Angst, aber auch nicht weit davon entfernt. Hier hatte sie immer das Gefühl, in eine permanente Krise hineinzugeraten, und dieses Gefühl unterlief das mühsam ausgeklügelte System, das sie entwickelt hatte, um sich nicht mit der eigentlichen Bedeutung ihres Leidensauseinandersetzen zu müssen. Seltsamerweise erging es ihr nicht so, wenn sie einen ihrer Kollegen in den Stationen besuchte, wo sie unweigerlich auf Patienten mit diabetesbedingten Komplikationen stieß.
Als Cassi und Thomas sich der Intensivstation näherten, wurde der Arzt von mehreren der wartenden Verwandten erkannt. Sofort drängten sie sich um ihn wie um einen Filmstar oder einen Sänger. Eine alte Frau berührte sein Gewand, als wäre er ein Gott in Menschengestalt. Thomas ließ sich nicht aus der Fassung bringen; er beantwortete ihre Fragen, erklärte, daß alle Operationen zufriedenstellend verlaufen seien und daß sie sich wegen weiterer Auskünfte an das Pflegepersonal halten müßten. Mit einiger Mühe gelang es ihm schließlich, sich zu befreien und in die Intensivstation zu flüchten, wohin ihm außer Cassi niemand zu folgen wagte.
Der Anblick der zahlreichen Maschinen, Monitore und Verbände verstärkte Cassis unausgesprochene Ängste. Und tatsächlich sah es so aus, als hätte man die Patienten inmitten all der Überwachungsgeräte völlig vergessen. Die Ärzte und Schwestern schienen sich in erster Linie ihren Geräten zu widmen.
Thomas ging von Bett zu Bett. Auf der Intensivstation hatte jeder Patient seine eigene, speziell ausgebildete Schwester, mit der Thomas sich unterhielt, ohne dem Patienten selbst mehr als einen flüchtigen Blick zu gönnen, es sei denn, die Schwester wies ihn auf irgendeine Anomalie hin. Er studierte die Lebenszeichen, soweit sie auf Registrierpapier festgehalten worden waren, überprüfte den
Weitere Kostenlose Bücher