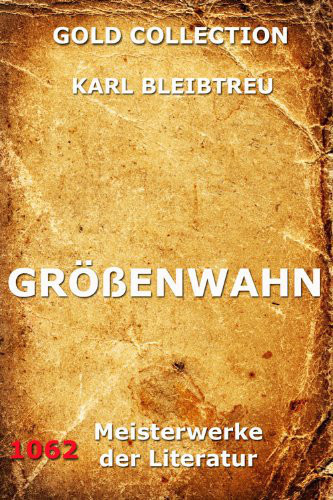![Größenwahn]()
Größenwahn
erblickte
Vom Regenbogen
Im Menschengewimmel
Einst eine liebliche lächelnde Maid,
Die Blumen pflückte,
Und ward ihr gewogen,
Trug zum Himmel
Den Liebling ins Reich der Seligkeit.
Schöner dort Alles,
Als auf Erden!
Die Blume glühte
Wie Demantschein!
Des Wasserfalles
Funke sprühte
Und schien zu werden
Ein Edelstein!
Und doppelt empfanden
Dort alle Sinne.
Wie Zephirfächeln
Die Stunden entschwanden.
Auf neue Wonnen sann immer die Fee,
Damit sie gewinne
Ein einziges Lächeln
Von der Erdentochter verschwiegenem Weh.
Denn ewig traurig
Sie Thränen vergoß.
Im Reich der Sphären
Ward es ihr schaurig.
Und holte Wasser die Fee aus der See,
Dann fielen Zähren
Vom Himmelsschloß
Und sie sah dort weinen die Maid in der Höh.
Schmachtend sie schaute
Zur Wolke nieder,
Die über der Erde
Düster braute.
»Was wünschest Du? Wonach sehnst Du Dich?
Zieht es Dich wieder
Zur Menschenheerde?
Sprich, o sprich!«
»Dort fallen Sterne
Und durch mein Haar
Gleich Perlenkränzen
Flöcht' ich sie gerne!«
Die Fee ihr brachte das Sternengeschmeid.
Umsonst sein Glänzen!
Und traurig war
Aufs neue die Maid.
»Fort, Gram, von der Stirne!
Was willst Du? Befiehl!«
Sie sprach: »Ich sehe
Manch schlanke Dirne
Dort unten tanzen im Frühlingshain.
Sie lachen zur Höhe
Im frohen Spiel,
Sie lachen mein.
Glücklicher freilich
Sind sie als ich.
Doch ihre Zöpfe
Sind mir nicht heilig.
Ballspielen möcht ich! Bringe mir
Der Dirnen Köpfe,
Zu trösten mich!«
Die Fee sprach: »Hier!«
Doch traurig wieder
Blickte die Maid
Mit heißen Zähren
Zur Erde nieder.
»Was dünket Dir denn noch wünschenswerth?
Ich wills gewähren,
Zu stillen Dein Leid,
Zu ersetzen die Erd'.«
»Jünglinge wandeln
So schön und lieb
Drunten heiter
Auf flinken Sandeln.
Ich bin im Himmel, doch bin ich allein.
Liebe nur gieb,
Ich will nichts weiter,
Liebe sei mein!«
Die schöne Dichterin legte die Rosapapierchen hin und blickte den Kritiker triumphirend an.
»Nun, was sagen Sie dazu?«
»Liebe sei mein!« hüstelte Leonhardt vorsichtig. »Sehr gut. Es ist ihr ewig Weh und Ach aus einem Punkte zu curiren.«
»Wie, wären Sie etwa mit der Pointe nicht einverstanden? O ich weiß, Sie Cyniker verachten die Liebe!«
»Gott soll mich bewahren! Nichts Menschliches verachte ich. Nur soll man die Dinge beim rechten Namen nennen.«
»Nun was wäre denn die Liebe nach Ihrer Auffassung, Verehrter?« Aurelie schlug kokett die Augen nieder.
Leonhart nahm eine gravitätische Magistermiene an und docirte bedächtig:
»Liebe ist verkappte Sehnsucht nach einer höheren Einheit, mit welcher der einsame Einzelmensch sich in Verbindung setzen möchte. So bildet der Geschlechtstrieb die Poesie im Kampf ums Dasein. So geistig ist der Mensch, daß selbst beim Sinnenkitzel er die Leidenschaft verlangt, die ihn unbewußt veredelt. Freilich, wie rächt sich diese geistige Unzucht! Aus süßester Hoffnung sauerste Enttäuschung, wie Essig aus verdorbenem Wein. – Aber was wird sonst nicht alles über den schönen Instinkt der Fortpflanzung gefabelt! Wenn ich den Namen ›Liebe‹ höre, muß ich schon lachen. O Lüge, dein Name ist Mensch! Wer mit seiner Humanität prahlt, ist meist ein Schurke, und sicher ist grade Der ein grober Sinnenmensch, der Heine's Dictum nicht unterschreibt: ›Denn weißt du, Kind, was Liebe ist? Ein Stern in einem Haufen Mist.‹«
»Ach Sie Schrecklicher, Sie sind Pessimist wie ich!« seufzte Aurelie und schmauchte ihre Papyros mit gedankenvollem Behagen. »Ach, wir Tiefempfindenden machen stets trübe Erfahrungen, nicht wahr?« Sie kreuzte ihre wohlgenährten Beine, so daß ihre Stiefeletten bis zu den Waden sichtbar wurden. »Wieviel Schufte und Narren vergällen uns das Leben!«
»Pah!« Leonhart reichte ihr jetzt eine seiner schlechten Cigarren dar, doch war ihr das zu starker Tobak. »Dann ginge es noch an. Aber 's ist ja viel langweiliger. Ein Franzose urtheilte triftig: Die Welt bestehe nicht aus Schuften und Narren, sondern aus Leuten, die nicht Talent genug haben, um das erstere, doch etwas zu viel, um das Letztere zu sein.«
»Madam Dudeffant bemerkt sehr schön: ›
Ceux qu'on nomme amis sont ceux par qui on n'a pas à craindre d'être assassiné, mais qui laisseront faire l'assassin!
‹« orakelte die geistreiche Dame, die an der Citatwuth litt.
Leonhart zuckte die Achseln. »Die Niederträchtigkeit der Männer und die Putz-Dummheit der
Weitere Kostenlose Bücher