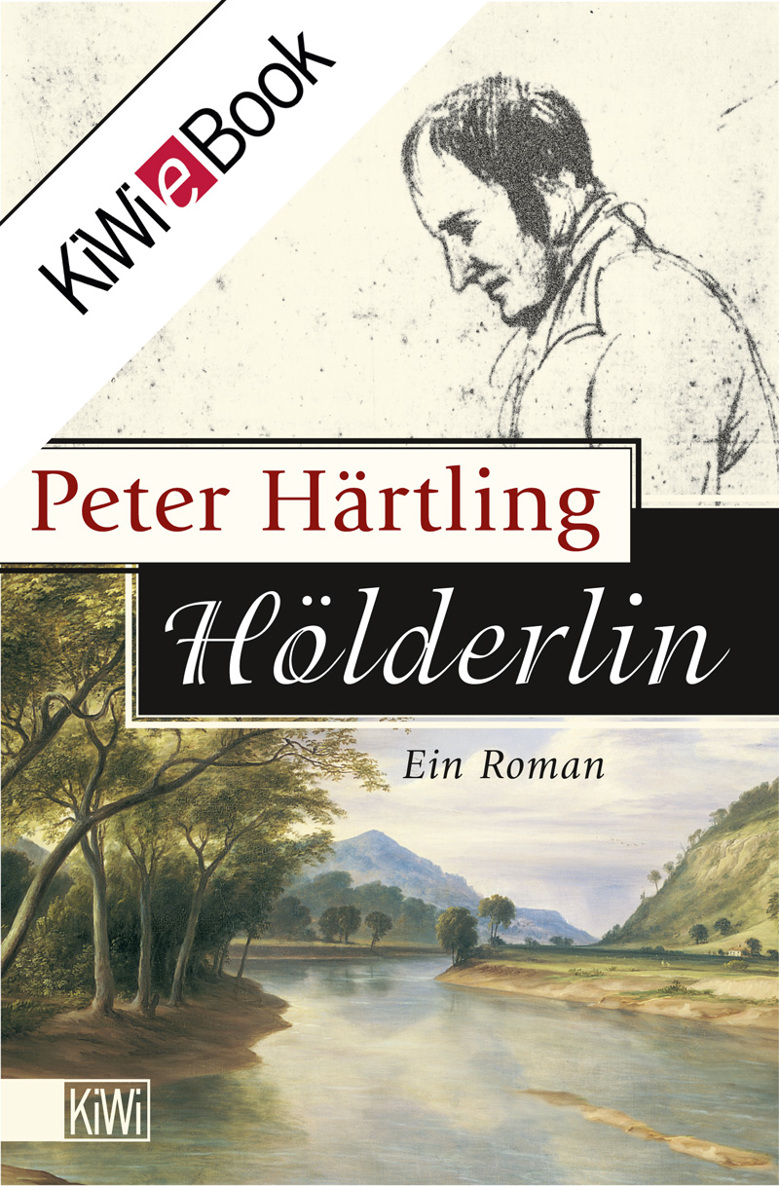![Härtling, Peter]()
Härtling, Peter
wohnen zu zehnt auf der Stube, die an dem Gang liegt, der seit je die »Jägerssphäre« genannt wird. Zu seiner Schlafstube ist der »Ochsenstall« bestimmt. Die Arbeit wird jetzt gedrängter, schwieriger, da die Theologievorlesungen am Stift gehalten werden, Ablenkungen, Fluchten in Gaststätten nicht mehr in dem Maße möglich sind wie zuvor beim Studium der »artistischen Fächer«, und die Lehrer größten Wert auf die Präsenz der Stipendiaten legen. Schelling freilich und ein anderer Neuling auf der Stube leben nach dem alten, für die fortgeschrittenen Studenten vergangenen Rhythmus, »D’r Kloi« war viel unterwegs, kehrte abgekämpft und überwältigt zu den »Augustinern« zurück. Bald aber wurde er respektiert wegen seiner phänomenalen Denkkraft und seiner rhetorischen Gaben.
Hölderlin trifft auf einer Auktion Elise Lebret. (Aber das muß eine Geschichte für sich sein, sie paßt nicht in die Chronologie, die ich, die Stift-Szene überschauend, herstelle.)
Sie geben sich Ratschläge, helfen sich bei den schriftlichen Arbeiten, erhitzen sich aber vor allem über die Lektüre, die nicht erwünscht, wenn nicht gar verboten ist, wobei Hegel sich in der Kenntnis Rousseaus hervortut, Schelling sich um Kant bemüht und Hölderlin, wenigstens für einige Wochen, von Leibniz besessen ist. Es sind Bilder angeregter, selbstsicherer Jugendlichkeit, wenn man sie argumentierend auf und ab gehen sieht, zu zweit oder in Gruppen, wenn sie sich um den scharen, der etwas gelesen hat, das ihn so erregt, daß er es den Freunden mitteilen muß.
Das gesellschaftliche Leben beschränkte sich auf den Umkreis der Universität. Hölderlins Freundeskreis ist größer geworden. Aber kein Haus nimmt ihn so auf wie das Stäudlinsche, nirgendwo fühlt er sich so angesprochen. Die förmlichen Besuche bei Lebret bedrücken ihn eher, er vermeidet sie, wann immer er kann. Neuffer und Magenau haben, was sie betrübt, nicht mehr den Vorrang wie früher. Es gibt keine Aldermann-Versammlungen mehr. Im »Lamm« jedoch sitzen sie weiter zusammen, genießen die karg bemessene Freiheit vom Studium, reißen derbe Witze, imitieren behagliche Bürgerlichkeit. Hölderlin bittet die Mutter, seinen Degen nach Tübingenzu schicken. Er hat sich im Ballhaus beim Fechtlehrer angemeldet.
Bei der ersten Begegnung mit Elise Lebret hatte er sich eher abweisend verhalten. Sie war ganz anders als Louise. Er versuchte, die Erinnerung an Louise aus seinem Gedächtnis zu drängen. Manchmal sah er Elise, sprach kaum mit ihr. Er hörte, sie halte ihn für hochmütig. Das war ihm, obwohl er ungerührt tat, nicht gleichgültig. An Neuffer, der, Krankheit vorschützend, öfter zu Hause in Stuttgart blieb, schrieb er aus dieser Verworrenheit:
»Ich bin zum Stoiker ewig verdorben. Das seh ich wohl. Ewig Ebb und Flut. Und wann ich mir nicht immer Beschäftigung verschaffte – oft aufzwänge, so wär ich wieder der alte. Du siehst, Herzensbruder! ›mein beßres Selbst willig‹ – wirst mir also verzeihen, wirst mich leiten, wo es not ist, aufheitern, wo es not ist.« Er fragt auch nach Stäudlin, sehr zurückhaltend nach dem Almanach, obwohl er doch nun mehr als hoffen kann, dort einige seiner Gedichte gedruckt zu sehen.
»Ewig Ebb und Flut« – im November 1790 hatte der Herzog mit größerem Gefolge das Stift besucht, die endgültige Formulierung und Verabschiedung der neuen Statuten gefordert. Unruhe unter den Studenten war die Folge. Dies alles bedrückte ihn, widerte ihn an. Der Wechsel der Stimmungen wurde noch heftiger. Im Schreiben aber gewann er, fast wie mit einem Sprung, größere Sicherheit. Er beschäftigt sich mit Leibniz, ohne philosophieren zu wollen, wie es ihm Schelling vorwirft, sondern als lernender Poet. Er nimmt die für ihn neue, seine Erfahrungen und Einsichten erweiternde Gedankenwelt im Gedicht auf: »Leibniz und mein Hymnus auf die Wahrheit hausen seit einigen Tagen ganz in meinemCapitolium.« Von Kant hatte er bereits die Trennung der Natur vom Geistigen gelernt; daß man die Natur als eine kausalmechanische Bewegung betrachten müsse, den Geist hingegen als eine aufs Endlich-Unendliche. Nun lernt er hinzu, daß das Mögliche, die Idee von etwas, der Entwurf, dem Wirklichen vorangehe. Das entspricht den politischen Erwägungen einiger Freunde, mehr aber noch dem Ziel seiner Poesie: der Entwurf, der die Wirklichkeit schafft. Seinen »Hymnus an die Wahrheit« nennt er um in »Hymnus an die Göttin der Harmonie«. »Geister! Brüder!
Weitere Kostenlose Bücher