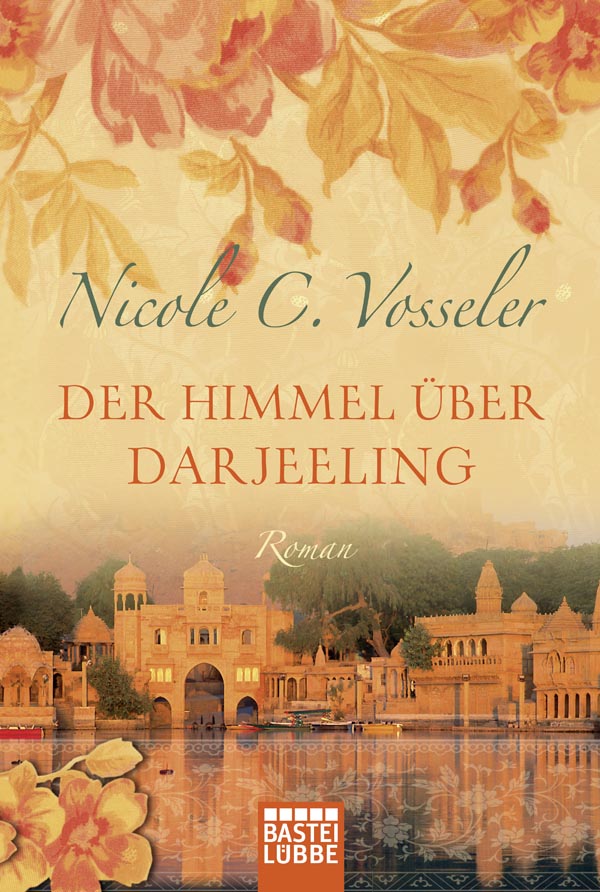![Himmel über Darjeeling]()
Himmel über Darjeeling
Herrschaft, darunter auch das der Chands. Surya Mahal und das dazugehörige Land waren durch die Kampfkunst seiner Krieger und das diplomatische Geschick vor allem des letzten Rajas Dheeraj Chand souverän geblieben, eines der letzten freien und unabhängigen Fürstentümer, wenn es auch in jenen unruhigen Jahren an ursprünglicher Größe und Bedeutung eingebüßt hatte.
Mit offenem Mund und leuchtenden Augen hatte Jason den Geschichten von Schlachten und Machtkämpfen gelauscht, den Legenden von stolzen Kriegern und mutigen Helden. Auch Helena hatte sich deren Zauber nicht entziehen können, hatte zu ahnen begonnen, dass die karge und dennoch beinahe unerträglich schöne Landschaft, die sie zu Pferd erkundeten, vom Blut vieler Generationen getränkt war, die ohne Erbarmen gegen sich wie ihre Feinde für ihre Freiheit, ihre Unabhängigkeit und ihre Ehre gekämpft hatten. Es war ein hartes, ein stolzes Land, wie die Menschen, die es bewohnten, und unwillkürlich war ihr Blick immer wieder zu Ian gewandert, an dem die Schilderungen Mohans ungerührt vorbeizuziehen schienen, als stießen sie bei ihm auf nicht das geringste Interesse – oder aber als hätte er sie bereits unzählige Male gehört.
So vieles hätte Helena Margaret zu erzählen gehabt – von dem prächtigen, bunten Fest, das zu Jasons zwölftem Geburtstag Ende Januar auf Surya Mahal ausgerichtet worden war; dem geduldigen Fuchswallach – »Kein Pony, ein richtiges großes Pferd!« –, den Ian ihm geschenkt hatte und auf dem ihm abwechselnd Ian und Mohan Tajid Reitunterricht gaben, zuerst im großen Haupthof des Palastes, dann in immer weiterer Entfernung der sicheren Mauern in der winterkühlen Steppe. Sie hätte davon berichten können, wie sie unter Djanaharas Anleitung die Stiche der traditionellen Stickereien auf der feinen Seide und gröberen Wolltüchern und die Zubereitung der Chutneysund der Gewürzmischungen, der masalas , der Küche Rajputanas erlernte und es ihr wider Erwarten Freude bereitete; von den langen Abenden am Kaminfeuer, an denen Mohan Tajid und Ian schweigend über dem Schachbrett saßen, während Jason in einem der dicken Wälzer aus der Bibliothek schmökerte und Helenas noch ungeübte Finger mit den haarfeinen bunten Garnen kämpften, die sich einfach nicht in die filigranen Muster legen wollten, oder Mohan die alten Mythen und Epen vorlas – die Bhagavadgita oder das ganze Mahabharata , die Upanishaden und das Ramayana, in denen Götter und Dämonen gegeneinander kämpften, Krieger und Könige, ganze Adelsfamilien, in kunstvoll geschmiedeten Versen litten und liebten, hassten und starben und gefeiert wurden.
Es wäre die Wahrheit gewesen, und doch wäre ihr diese Schilderung eines ungetrübten Idylls falsch vorgekommen, unvollständig. Denn da waren die Momente, in denen sich ihr Blick mit dem Ians traf, in denen das Feuer in seinen Augen sie schlucken ließ und ihr den Atem nahm; Nächte, in denen sie unter seinen Berührungen und Küssen zu verglühen und sich aufzulösen glaubte und die die leeren Laken an ihrer Seite am nächsten Morgen noch eisiger wirken ließen. Augenblicke, in denen er mit ihr lachte und scherzte, gesprächig wurde, von der Geschichte des Palastes erzählte, den Familien der Chands und Suryas, davon, dass er beinahe ein Jahrzehnt seines Lebens auf Surya Mahal verbracht hatte, um beim nächsten Atemzug zu verstummen, als sie nach dem Grund dafür fragte, seine Augen kühl und glatt wie aus Onyx geschnitten, sein Gesicht eine undurchdringliche Maske der Abwehr. Es gab Momente des Glücks, in denen sie einander so nahe waren, dass Helena es kaum ertrug, und ebenso viele, in denen Ian Kälte und Härte ausstrahlte, mit der er sie derart auf Distanz hielt, dass sie in seiner Gegenwart zu frösteln begann.
Wie hätte sie in Worte fassen können, was ihr selbst vollkommen unbegreiflich erschien? Wie hätte sie Margaret, ihrer Marge, erklären können, dass sie sich danach sehnte, ihn zu verstehen, sein Leben und das zu teilen, was ihn bewegte und beschäftigte, wenn diese Sehnsucht doch so neu und unfassbar für sie selbst war? Und es wäre ihr wie ein Verrat erschienen, hätte sie sich beklagt, denn es gab keinen Grund dafür, und doch konnte sie sich nicht glücklich nennen. Es war, als spürte sie das Glück in ihrer Nähe und wüsste nicht, wohin sie greifen sollte, um es zu fassen zu bekommen.
Helena legte den Federhalter beiseite und spürte dem Ziehen in ihrem Unterleib nach. Ihr Unwohlsein,
Weitere Kostenlose Bücher