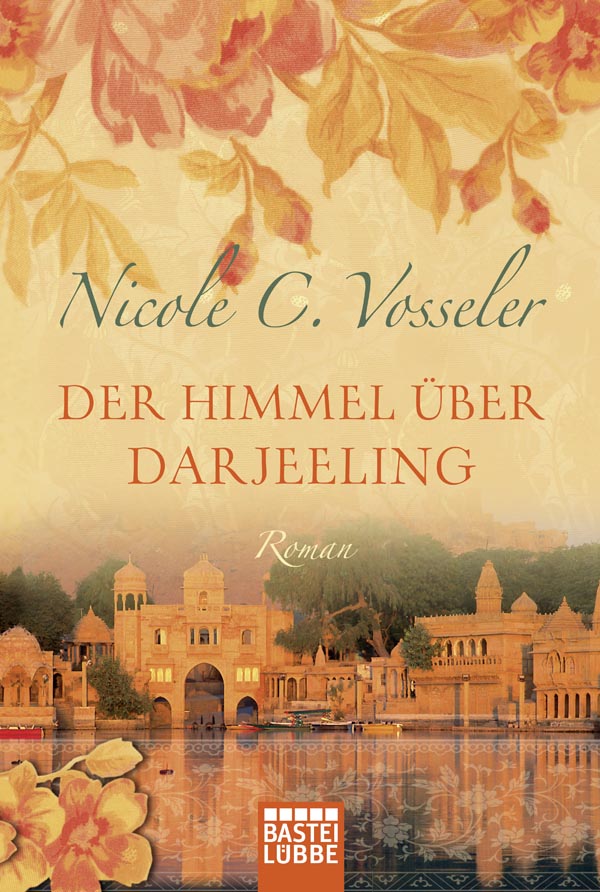![Himmel über Darjeeling]()
Himmel über Darjeeling
– Stute – Fohlen, ehe sie die Treppe hinabeilte.
Helena zögerte einen Augenblick, wollte wieder zu Bett gehen, doch trotz ihrer Schlaftrunkenheit fühlte sie sich hellwach. Hastig stieg sie in Hemd und Hosen, band sich die Haare fest im Nacken zusammen und schlüpfte in ihre Stiefel; dann rannte sie hinunter.
Es war eine kühle Nacht. Ein feiner Regen fiel, kaum mehr als ein Nebel, und doch ließ er, zusammen mit ihrer Müdigkeit, Helena mit den Zähnen klappern. Die Arme fest um den Körper geschlungen, lief sie mit großen Schritten in Richtung der Ställe. Schon von weitem sah sie Licht brennen, konnte sie ein, zwei sich bewegende Schattenrisse vor dem helleren Hintergrund erkennen. Ein Stallknecht sah sie verwundert an und grüßte sie murmelnd, als sie hereinkam. Hier war es warm, und die aus ihrem Schlaf geschreckten Pferde, deren vertrauter Geruch sie empfing, beäugten sie über den Rand ihrer Boxen hinweg neugierig, fast fragend; ein oder zwei wieherten in leiser Besorgnis. Die mittlere Box auf der rechten Seite war heller beleuchtet als der Rest des Stalls, und Helena sah Mohan Tajid vor dem geöffneten Tor stehen. Die Lage musste wirklich sehr ernst sein, denn er hatte sich nicht einmal die Zeit genommen, seinen Turban zu wickeln, trug nur ein einfaches Hemd und Reiterhosen. Es war das erste Mal, dass sie ihn barhäuptig zu Gesicht bekam, sein kurzgeschnittenes, einstmals kohlschwarzes Haar fast völlig ergraut, wenn auch noch immer sehr dicht. Als er sie ansah, blieb sie einen angstvollen Moment lang stehen, fürchtete, er würde sie mit einer Geste, einem Kopfschütteln zum Gehen auffordern, doch stattdessen nickte er kurz, und sie glaubte, den Anflug eines Lächelns gesehen zu haben. Vorsichtig trat sie näher.
Ian kniete vor einer schwarzen Stute, die auf dem Stroh lag, gekrümmt in eine Ecke gedrückt, ihre Flanken zum Platzen angeschwollen. Helena wusste nicht, ob er überhaupt geschlafen hatte; er trug das gleiche Hemd wie wenige Stunden zuvor, nur wirkte er jetzt hellwach und nüchtern. Beruhigend redete er auf das verängstigte, offensichtlich Schmerzen leidende Tier ein, tastete seinen Körper ab. Der Atem des Pferdes ging schnell und flach, Nüstern und Augen hatte es weit aufgerissen, und Letztere blickten matt in Helenas Richtung, schienen sie jedoch gar nicht wahrzunehmen. Helena fühlte sich hilflos. Sie wusste wenig über Pferde, allein, wie man sie ritt und versorgte, aber sie war noch nie zugegen gewesen, wenn eine Stute gefohlt hatte.
»Sarasvati«, flüsterte Mohan neben ihr. »Es ist ihr erstes Fohlen. Shiva ist der Vater. Bis heute Nacht sah alles nach einer normalen Geburt aus – aber jetzt …«, er zuckte ratlos mit den Achseln.
»Ein Tierarzt?«, flüsterte Helena zurück. Mohan schüttelte den Kopf.
»Der einzige im Umkreis von vielen Meilen ist ein Metzger. Ian würde ihm niemals eines seiner Pferde anvertrauen. Zum Glück hat uns einer der Burschen gleich geweckt, nachdem er es bemerkte.«
Helena zögerte einen Augenblick, dann trat sie langsam, um die Stute nicht zu erschrecken, in die Box. Das Stroh raschelte unter ihr, als sie sich hinkniete, behutsam die Stirn und Nase streichelte. Sarasvatis Hufe zuckten unkontrolliert, als eine heftige Wehe durch ihren Körper lief. Voller Schmerz und Angst sah sie zu Helena auf, bettete dann müde den Kopf in ihren Schoß. Helena kraulte ihr schweißnasses Fell, flüsterte ihr Kosenamen zu, bat sie durchzuhalten, versprach ihr, dass alles gut würde. Verstohlen sah sie zu Ian, der ihre Anwesenheit nicht einmal bemerkt zu haben schien. Sein Gesicht, von Bartstoppeln verdüstert, zeigte Verzweiflung und Wut, und gleichzeitig ging er so liebevoll mit dem Tier um, dass Helenas Herz sich gegen ihren Willen erwärmte.
Es wurde eine lange Nacht für sie alle, und im Nachhinein hätte Helena nicht mehr sagen können, wie sie es geschafft hatten, sie, Ian, Mohan Tajid, Sarasvati und zwei der Stallburschen. Helena kam es vor, als hätte sich alles in der schattenhaften Welt zwischen Traum und Wirklichkeit abgespielt. Aber als es hell war, war das Fohlen da, wirklich und greifbar, schwarz wie seine Mutter, in eine glitschige, weißlich violette Membran gehüllt, von dem sie es eilig befreiten, dann den schmalen, nassen Körper mit Strohbündeln abrieben. Auf zittrigen Beinen stand Sarasvati da, beäugte mit schweren Augenlidern scheinbar fassungslos das Kleine, das ihr so viel Mühe gemacht, ihr so viele Schmerzen verursacht hatte.
Weitere Kostenlose Bücher