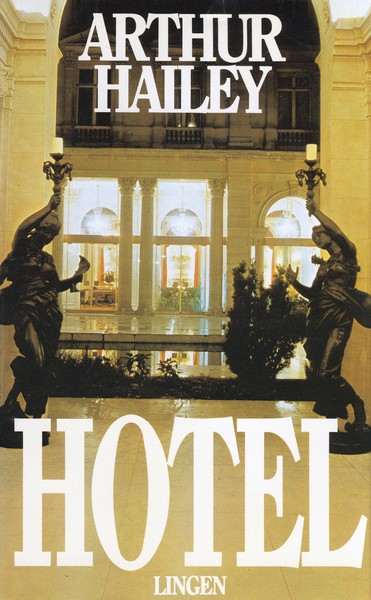![Hotel]()
Hotel
kam dann schließlich so, daß sie mir ein Stipendium anboten und daß ich von der Oberschule dahin überwechselte. Später fand ich heraus, daß Herb ein paar Hotelleute dazu überredet hatte, meine Aufnahme zu befürworten. Er war ein guter Vertreter, glaube ich.«
»Sie glauben es nur?«
»Ich war mir nie ganz sicher«, erwiderte Peter versonnen. »Ich verdanke Herb Fischer eine Menge, aber manchmal fragte ich mich, ob die Leute nicht nur deshalb soviel für ihn taten und Geschäfte mit ihm machten, weil sie ihn loswerden wollten. Er ging einem entsetzlich auf die Nerven. Ich sah ihn nur noch ein einziges Mal, nachdem die Sache mit Cornell geklappt hatte. Ich wollte mich bei ihm bedanken und gab mir alle Mühe, ihn gern zu haben. Aber er ließ beides nicht zu – warf nur mit großen Worten um sich und prahlte mit den Abschlüssen, die er gemacht hatte oder machen wollte. Dann sagte er, für das College brauchte ich ein paar anständige Anzüge, was stimmte, und drängte mir förmlich zweihundert Dollar als Darlehen auf. Für ihn muß das ein Haufen Geld gewesen sein, denn ich erfuhr später, daß es mit seinen Kommissionen nicht weit her war. Ich zahlte ihm das Geld in Raten zurück, aber meistens löste er meine Schecks gar nicht ein.«
»Das Ganze klingt wie ein Märchen.« Christine hatte gespannt zugehört. »Warum besuchen Sie ihn nicht mehr?«
»Er ist tot. Ich verabredete mich noch ein paarmal mit ihm, aber irgendwie schafften wir es beide nicht. Dann, vor ungefähr einem Jahr, rief mich sein Anwalt an – Herb hatte offenbar keine Familie. Ich ging zum Begräbnis. Und dort entdeckte ich dann, daß es acht von uns gab – allen hatte er auf die gleiche Art geholfen wie mir. Das Merkwürdige daran war, daß er, trotz seiner Prahlerei, keinem von uns von den anderen sieben erzählt hatte.«
»Ich könnte heulen.«
Er nickte. »Ich weiß. Genauso war mir damals zumute. Die Geschichte hat sicher irgendeine Moral, nur bin ich nie dahintergekommen, welche. Vielleicht könnte man sagen, daß manche Menschen eine große feste Schranke aufrichten und sich dabei glühend wünschen, daß jemand sie niederreißt, und wenn man das nicht tut, lernt man sie niemals richtig kennen.«
Während des Kaffees schwieg sich Christine aus; sie hatten beide auf den Nachtisch verzichtet. Schließlich fragte sie: »Wissen wir denn wirklich, was wir uns wünschen?«
Peter überlegte. »Nur zum Teil, nehme ich an. Aber ich kenne etwas, das ich haben möchte – das oder wenigstens etwas Gleichartiges.« Er ließ sich die Rechnung bringen.
»Sagen Sie’s mir.«
»Ich hab’ eine bessere Idee: ich zeig’s Ihnen.«
Draußen vor dem Restaurant blieben sie stehen, um sich nach der Kühle im Inneren an die warme Nachtluft zu gewöhnen. In der Stadt war nicht mehr so viel Betrieb wie noch vor einer Stunde. Einige Lichter in ihrer Umgebung verlöschten; das nächtliche Treiben im Viertel versickerte in andere Bezirke. Peter faßte Christine unter und führte sie schräg über die Royal Street. An der Südwestecke von St. Louis machten sie halt und wandten den Blick geradeaus. »So etwas würde ich gern aufbauen«, sagte er. »Etwas ebenso Gutes oder vielleicht noch Besseres.«
Unter anmutig geschwungenen schmiedeeisernen Balkons und geriffelten Säulen warfen flackernde Gaslaternen Licht und Schatten auf die weißgraue klassische Fassade des Royal-Orleans-Hotels. Durch gebogene, längsgeteilte Fenster fiel ambrafarbenes Licht nach draußen. Auf dem breiten Gehsteig spazierte ein Türhüter in reichbetreßter Uniform auf und ab, auf dem Kopf eine pillenschachtelförmige Mütze. Hoch oben knatterten Fahnen in einer plötzlich aufkommenden Brise an ihren Masten. Ein Taxi fuhr vor. Der Türhüter trat rasch heran, um die Wagentür zu öffnen. Hohe Absätze klickten, Gelächter klang auf, und das Paar verschwand im Hotel. Eine Tür knallte zu. Das Taxi fuhr ab.
»Ein paar Leute halten das Royal Orleans für das beste Hotel in Nordamerika«, sagte Peter. »Ob man dem beipflichtet oder nicht, spielt keine Rolle. Der springende Punkt ist: es beweist, wie gut ein Hotel sein kann.«
Sie überquerten St. Louis und gingen auf das Gebäude zu, das früher einmal Hotel und Zentrum der kreolischen Gesellschaft gewesen war, dann Sklavenmarkt, Hospital im Bürgerkrieg, Sitz der Regierung und nun wieder Hotel. Peters Stimme klang immer begeisterter. »Es hat alles, was ein gutes Hotel haben muß – Geschichte, Stil, moderne technische
Weitere Kostenlose Bücher