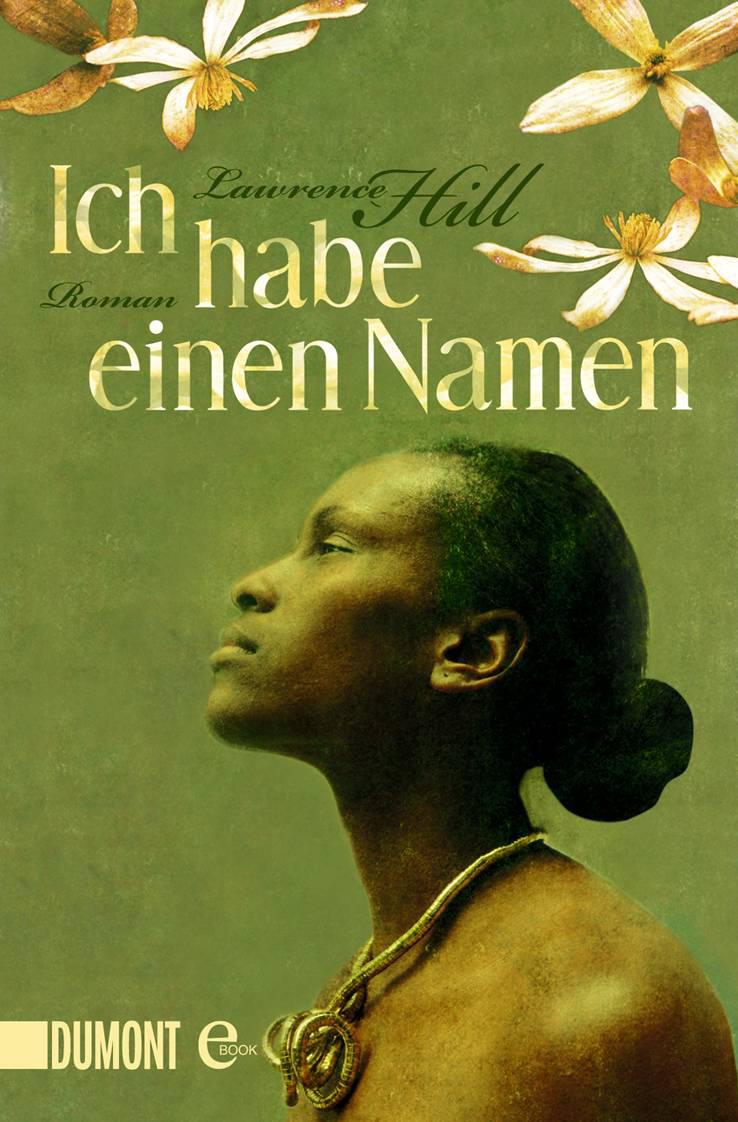![Ich habe einen Namen: Roman]()
Ich habe einen Namen: Roman
bewegen. Wie ein Kind, das zu seiner Mutter gezogen wurde, trieb ich zu
ihnen.
In der Mitte des
Kreises stand eine wehklagende Afrikanerin und hielt den Körper eines Kindes.
Sein Kopf war unbedeckt, sein Leib in einen indigofarbenen Stoff gewickelt. Um
die Taille hingen einige blaue, grüne und weiße Glasperlen. Die Frau legte das
Kind in die Erde, und ein Mann mit einer Schaufel füllte die Grube. Darüber
errichteten mehrere Frauen einen perfekt runden Steinhügel, während andere
weitere angespitzte Stöcke zu einem etwa kindsgroßen Rechteck in den Boden
steckten.
Ich bewegte mich mit
den Wehklagen, bis ich schließlich mitten unter den Leuten stand, mit ihnen
schluchzte und mich wiegte. Einige der Trauernden hatten gezeichnete Gesichter,
aber niemand hatte meine Monde und sprach Bambara oder Fulfulde. Sie nahmen
mich auf und fragten nicht, woher ich kam, denn sie mussten mich nur ansehen
und mein Schluchzen in der Sprache meiner Mutter hören, um zu erkennen, dass
ich eine von ihnen war. Das tote Kind war das Kind, das ich einst gewesen war.
Es war mein verlorener Mamadu. Es war jeder einzelne Mensch, der während der
endlosen Reise über den großen Fluss in die unversöhnliche See geworfen worden
war.
Als die Zeremonie
vorüber war, wandte sich ein älterer Mann zurück Richtung Stadt, und die
anderen folgten ihm in einer Einerreihe. Ich ging neben der Frau ganz hinten in
der Reihe.
»Wo wohnt ihr?«, fragte
ich. Sie sprach kein Englisch, also richtete ich mich an die Frau vor ihr und
wiederholte meine Frage: »Wo wohnt ihr?«
»Es gibt überall
Afrikaner«, sagte sie. »Einige in Canvas Town, kennst du das?«, fragte sie. Ich
nickte. »Einige wohnen bei den Weißen, denen wir gehören.«
»Einige von euch sind
frei und andere nicht?«, fragte ich.
»Keiner von uns ist
wirklich frei, bevor wir nicht zurück in unsere Heimat kommen.«
»Und wo ist euer Land
in Afrika?«
»Wir kommen von überall
her«, sagte sie und machte eine Bewegung zu den vor ihr Gehenden hin. »Ich
selbst bin eine Ashanti.«
Ich kannte das Wort
nicht und wiederholte es.
»Und du?«, fragte sie.
»Ich bin eine Fulbe«,
sagte ich, »und eine Bambara.«
»Ein bisschen von
allem?«, sagte die Frau. »Das mag ich hier.«
»Lebst du in Canvas
Town?«
»Nein«, sagte sie. »Ich
arbeite im Haus eines Mannes aus England, der sagt, dass er mich eines Tages
freigeben wird. Aber in diesem Land gibt es keine Freiheit. Hier gibt es nur
Essen im Bauch, Kleider auf dem Körper und ein Dach gegen den Regen. Die Heimat
ist der einzige Ort der Freiheit. Das Baby, das wir begraben haben, ist auf dem
Weg zurück nach Hause. Hast du das gefärbte Glas gesehen?«
»Die Perlen um seinen
Leib?«
»Die bringen seinen
Geist zurück über das Wasser, in die Heimat, in die er gehört.«
Ich lächelte die Frau
an und blieb stehen. Wir kamen näher an die Stadt heran, als ich wollte.
»Es ist ein gutes
Versteck«, sagte die Frau. »Die Toubabu kommen nicht zu unserem
Bestattungsfeld.«
Sie hob die Hand zum
Gruß und wandte sich ab. Die Afrikaner gingen weiter südwärts, und keiner von
ihnen sah sich zu mir um.
Nach zwei
weiteren Tagen und Nächten im Wald klopfte ich an die Hintertür von Fraunces
Tavern. Ich wartete, klopfte wieder, und endlich machte mir Sam auf.
»Sieh dich an«, sagte
er.
Ich zitterte. Meine
Kleider waren nass und schmutzig.
»Ist er hier?«, fragte
ich.
»Er ist noch am selben
Tag abgereist«, sagte Sam. »Er kam eine Stunde, nachdem du gegangen warst, und
hat das nächste Schiff Richtung Süden genommen.«
»Könnte ich etwas zu
trinken und zu essen bekommen?«
»Ich hole dir was,
während du dich umziehst.«
»Hat er meine Sachen
hiergelassen?«
»Ich habe deine Tasche
versteckt und ihm gesagt, du hättest sie mitgenommen.«
»Ich stehe in deiner
Schuld«, sagte ich.
Er legte mir eine Hand
auf die Schulter. »Du wirst zweifellos noch etwas tiefer sinken, aber keine
Angst, du schaffst das schon.«
Ich traf eine Abmachung
mit Sam Fraunces. Er zahlte mir fünf Schilling die Woche und ließ mich auf
einem provisorischen Bett in einem vollgepackten Abstellraum schlafen und mit
dem Küchenpersonal essen. Dafür arbeitete ich täglich sechs Stunden für ihn.
Ich spülte Teller, wischte Böden, säuberte Gemüse, leerte Nachttöpfe und
schrieb Rechnungen und Quittungen, aber ich wusste, das war nur eine
vorübergehende Lösung. Sam Fraunces’ Gasthaus war kaum ein sicherer Ort, um
mich vor Lindo zu verstecken.
In der
Weitere Kostenlose Bücher