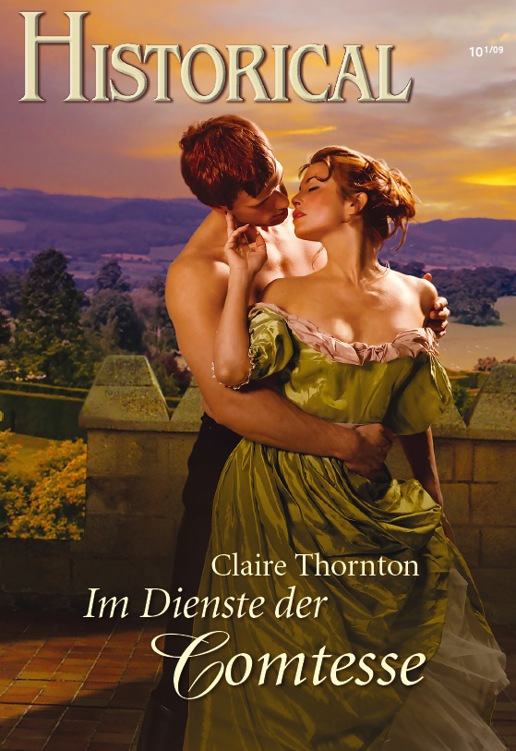![Im Dienste der Comtesse]()
Im Dienste der Comtesse
Dame derart ramponiert zu erscheinen.“
Pierre schmunzelte. „Ich werde den Stuhl der Dame so hinstellen, dass sie Ihnen den Rücken zukehrt. Dann kann sie sich vorstellen, Sie wären vollendet gekleidet – und Ihre Probleme sind gelöst.“
Überrascht und fasziniert verfolgte Mélusine diesen Wortwechsel. Saint-André war immer höflich zu Bediensteten gewesen, aber noch nie hatte sie ihn mit einem Diener sprechen hören, als wäre er ein Gleichgestellter. Der Marquis hatte zwar weder gelacht noch gelächelt, aber sie merkte, dass Pierres Bemerkung ihn amüsierte.
„Monsieur, natürlich stört mich Ihre Aufmachung nicht“, versicherte sie Saint-André. „Doch nicht unter diesen Umständen! Bitte, nehmen Sie wieder Platz.“ Sie zögerte. „Sie beide“, fügte sie entschlossen hinzu und spürte, dass sie errötete. Es war eine Sache gewesen, zwei Bedienstete aufzufordern, sich zu setzen, als Daniel sie besucht hatte. Einen Diener in Gesellschaft eines Marquis dazu aufzufordern, war etwas ganz anderes. Aber wie konnte sie erst auf Pierres Schoß sitzen und ihn küssen, solange sie allein waren – und ihn dann in vornehmer Gesellschaft wie ein Möbelstück behandeln?
Sie war darauf gefasst, ihr Tun rechtfertigen zu müssen, aber zu ihrer Erleichterung ging keiner der beiden Männer darauf ein.
„Madame, ich würde gern zu unserer unbefangenen Freundschaft zurückfinden, die uns einst verbunden hat“, begann Saint-André. „Dazu müssen wir allerdings wohl erst einmal auf weniger angenehme Dinge zu sprechen kommen, ehe wir diese endgültig ad acta legen können. Es tut mir über alle Maßen leid, dass Sie das Gespräch mit Bertier in jener Nacht mitangehört haben. Ich kann mir Ihr Entsetzen nur allzu gut vorstellen.“
Trotz ihres Vorsatzes, völlig gefasst aufzutreten, konnte Mélusine ihm nicht in die Augen sehen. Es war unerträglich peinlich und erniedrigend, an das zu denken, was Bertier von Saint-André verlangt hatte, während der Marquis in ihrer Nähe saß und sie beobachtete.
„Madame, ich hätte das niemals getan“, fuhr er sanft fort. „Habe ich Ihnen je von meiner Mutter erzählt?“
Der plötzliche Themenwechsel überraschte sie – und sie sah auf. „Nein.“
„Mein Vater verdächtigte sie der Untreue, als ich acht Jahre alt war. Zur Strafe ließ er sie für den Rest ihres Lebens in ein Kloster sperren“, erzählte Saint-André. „Er erlaubte ihr nicht, ihre Kinder zu sehen, und das habe ich ihm nie verziehen. Als er starb, hatte ich seit zehn Jahren nicht mehr mit ihm gesprochen.“
In all den Jahren, die Mélusine ihn kannte, hatte sie ihn nie anders als mit ruhiger Stimme sprechen hören. Doch als er nun über seine Eltern sprach, veränderte sich sein Tonfall und wurde hart vor Schmerz – eine Wunde, die nie verheilt war.
„In dieser Hinsicht hatte ich etwas mit Bertier gemeinsam, obwohl wir nur selten darüber redeten“, fuhr der Marquis fort. „Sein Vater hatte seine Mutter zwar niemals eingesperrt, aber sie hassten sich. Als sie starb, löschte sein Vater jeden Hinweis darauf, dass sie jemals Teil seines Lebens war. Bertier wurde übrigens mit zwanzig von einem Freibeuter als Geisel genommen, wussten Sie das?“
„Nein!“ Mélusine war vollkommen erstaunt über diese Enthüllungen. „Was geschah danach?“
„Sein Vater weigerte sich, das Lösegeld zu zahlen. Deshalb stand für Bertier außer Zweifel, dass sein Vater ihn am liebsten ebenfalls aus seinem Leben gestrichen hätte. Ich scheine etwas vom Thema abgekommen zu sein“, entschuldigte sich Saint-André. „Zu lange Zeit nur in meiner eigenen Gesellschaft ist wohl der Grund für meine schlechte Angewohnheit der Weitschweifigkeit. Madame, um es kurz zu machen: Ich würde niemals absichtlich Sie – und auch keine andere Frau – dem Risiko aussetzen, das Schicksal meiner Mutter zu erleiden.“
Mélusine dachte gründlich über das nach, was sie gehört hatte. „Sie haben keine Affären mit verheirateten Frauen“, sagte sie und erkannte erstmals, dass sie in einer Gesellschaft, in der Ehebruch nicht nur an der Tagesordnung, sondern sogar in Mode war, noch nie diesbezügliche Gerüchte über Saint-André vernommen hatte.
„Nein.“
„Bertier muss das gewusst haben.“
„Ja, natürlich.“
„Warum hat er dann …?“
„Warum er mich darum gebeten hat? Warum er angenommen hat, ich würde es trotz meiner sonstigen Skrupel tun? Warum Sie meinen Protest nicht gehört haben, sobald er diesen
Weitere Kostenlose Bücher