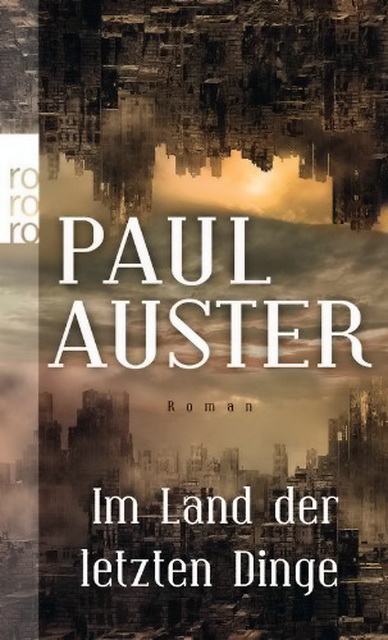![Im Land der letzten Dinge (German Edition)]()
Im Land der letzten Dinge (German Edition)
überhaupt wert war, ob es tatsächlich nicht besser wäre, gar nichts zu tun, als Leuten Geschenke hinzuhalten, um sie ihnen im nächsten Augenblick wieder aus den Händen zu reißen. Das Ganze war im Grunde grausam, und häufig fand ich es unerträglich, erwachsene Männer und Frauen zu sehen, die plötzlich vor einem auf die Knie fielen und um einen einzigen zusätzlichen Tag bettelten, Zeuge zu sein von Tränen, Geheul und wütendem Flehen. Manche täuschten Krankheit vor – fielen in tiefe Ohnmachten, stellten sich gelähmt; andere gingen so weit, sich vorsätzlich zu verletzen: sie schlitzten sich die Handgelenke auf, durchbohrten sich mit Scheren die Beine, schnitten sich Finger und Zehen ab. Im äußersten Fall kam es zu Selbstmorden; an mindestens drei oder vier kann ich mich erinnern. Man glaubte, wir würden in Woburn House den Menschen helfen, doch die Wirklichkeit sah zuweilen so aus, dass wir sie vernichteten.
Das Dilemma ist freilich auch gewaltig. Sobald man den Gedanken akzeptiert, an einem Ort wie Woburn House möchte irgendetwas Gutes sein, versinkt man in einem Sumpf von Widersprüchen. Das Argument, man sollte den Gästen erlauben, länger zu bleiben, zieht einfach nicht – zumal wenn man fair sein will. Was ist mit all den anderen, die draußen stehen und darauf warten, eingelassen zu werden? Auf jeden, der in Woburn House ein Bett belegte, kamen Dutzende, die draußen um Einlass bettelten. Was ist besser – einer großen Zahl von Leuten ein bisschen zu helfen, oder einer kleinen Zahl richtig? Ich glaube, auf diese Frage gibt es schlichtweg keine Antwort. Dr. Woburn hatte das Unternehmen auf eine bestimmte Weise angefangen, und Victoria war entschlossen, bis zum Ende daran festzuhalten. Dadurch wurde es nicht unbedingt richtig. Aber falsch wurde es damit auch nicht. Das Problem lag nicht so sehr in der Methode als in der Natur des Problems selbst. Es gab zu viele Leute, denen geholfen werden musste, und nicht genug Leute, die ihnen helfen konnten. Dieser Rechnung war nichts entgegenzusetzen; sie hatte in jedem Fall schlimme Folgen. Man konnte so hart arbeiten, wie man wollte, das Scheitern stand immer schon fest. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Wenn man nicht bereit war, die vollkommene Vergeblichkeit der Arbeit zu akzeptieren, brauchte man gar nicht erst damit weiterzumachen.
Meine Hauptaufgabe bestand darin, mit zukünftigen Gästen Vorstellungsgespräche zu führen, ihre Namen in eine Liste einzutragen und einen Plan zu erstellen, wer wann einziehen sollte. Die Vorstellungsgespräche wurden von neun Uhr morgens bis ein Uhr mittags abgehalten, wobei ich täglich im Durchschnitt mit zwanzig bis fünfundzwanzig Leuten sprach. Ich empfing sie getrennt, einen nach dem anderen, in der Eingangshalle des Hauses. In der Vergangenheit hatte es offenbar einige hässliche Vorkommnisse gegeben – gewaltsame Überfälle; Gruppen von Leuten, die durch die Tür zu stürmen versuchten –, weshalb jetzt während der Sprechzeiten stets ein bewaffneter Posten Wache zu halten hatte. Dieses Amt wurde von Frick versehen, der mit einem Gewehr auf der Vordertreppe stand und die Menge überwachte, damit die Schlange sich ruhig vorwärtsbewegte und die Lage nicht außer Kontrolle geriet. Die Massen vor dem Haus konnten einem den Atem verschlagen, besonders in den warmen Monaten. Es war nichts Ungewöhnliches, wenn sich zu jeder beliebigen Stunde fünfzig bis fünfundsiebzig Leute da draußen auf der Straße drängten. Das bedeutete, dass die meisten, die ich empfing, drei bis sechs Tage nur auf die Chance eines Vorstellungsgesprächs gewartet hatten – auf dem Bürgersteig geschlafen, sich zentimeterweise in der Schlange voranbewegt, beharrlich durchgehalten hatten, bis sie endlich an die Reihe kamen. Einer nach dem anderen taumelten sie zu mir herein, ein endloser, unaufhörlicher Strom von Menschen. Sie setzten sich auf den roten Lederstuhl mir gegenüber an den Tisch, und ich stellte ihnen die notwendigen Fragen. Name, Alter, Familienstand, frühere Beschäftigung, letzter fester Wohnsitz und so weiter. Das nahm nie mehr als ein paar Minuten in Anspruch, aber nur selten war ein Gespräch damit beendet. Alle wollten sie mir ihre Geschichte erzählen, und mir blieb nichts anderes übrig als zuzuhören. Die Geschichten waren jedes Mal verschieden, und doch liefen sie stets auf dasselbe hinaus. Die Pechsträhnen, die Fehleinschätzungen, die wachsende Last der Umstände. Unser Leben ist nichts anderes als die
Weitere Kostenlose Bücher