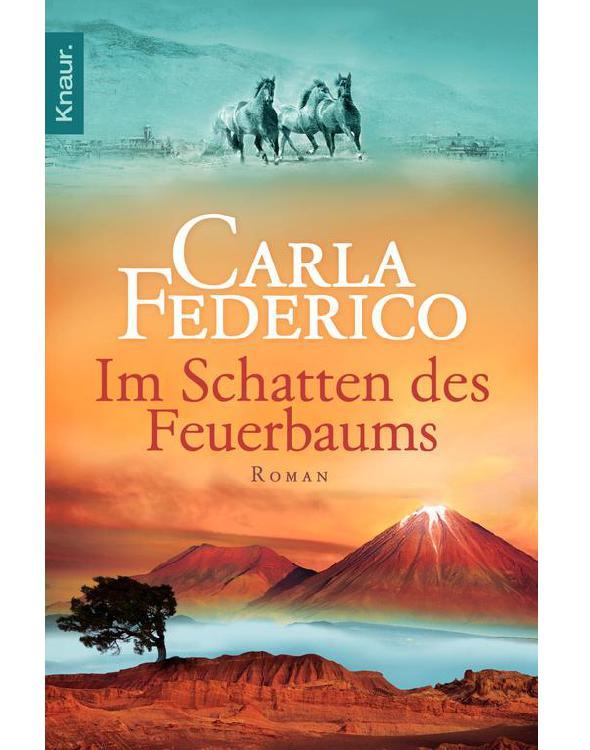![Im Schatten des Feuerbaums: Roman]()
Im Schatten des Feuerbaums: Roman
Gesellschaft, ja, in ein besseres Leben. Lebst du mit ihm im Streit, strafst du nicht ihn! Du schneidest dir nur selbst ins Fleisch.«
Andrés konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Er schnitt doch gerne ins Fleisch. »Nein, ich schade nicht mir« erklärte er bockig, »sondern vor allem dir. Du willst doch zur Oberschicht gehören, du willst ein Krankenhaus führen. Ich begnüge mich gerne mit dem, was wir haben.«
»Ich will vor allem nicht arm sein«, murmelte Ramiro, und die Verzweiflung wich der Resignation.
Andrés’ Widerstand bröckelte. Obwohl der Vater nichts mehr sagte, konnte er förmlich hören, was er dachte.
Arm wie damals, als Andrés’ Mutter gestorben war. Im Wochenbett, bei seiner Geburt, weil es keine ausreichende medizinische Betreuung gegeben hatte. Obwohl angehender Mediziner, war der Vater gegen die Sepsis machtlos gewesen.
Sie sprachen fast nie über sie, die fremde Mutter, von der er nur eine Fotografie kannte, eine Frau mit kohlschwarzen Augen wie … Aurelia, genauso klein wie sie, genauso zart, kein Wunder, dass sie seine Geburt nicht überlebt hatte. Wobei – Aurelia hatte Tinos Geburt überlebt, obwohl damals kein Arzt zugegen war.
»Alles, was ich tue, tue ich nur für dich«, brach es aus Andrés hervor. Er war nicht sicher, was ihn zu seinen Worten bewog, konnte jedoch nicht aufhören zu sprechen, nachdem er begonnen hatte. »Wie es mir geht, wie ich mich fühle, ist dir doch gleichgültig. Oder vielleicht ist es dir gar nicht gleichgültig und du wünschst dir sogar, dass es mir nicht gutgeht. Hast du mir je verziehen, dass meine Mutter bei meiner Geburt gestorben ist?«
Eine Zornesfalte grub sich auf Ramiros Stirn ein, aber sein Blick flackerte verlegen. »Red keinen Unsinn!«, schrie er. »Nicht du trägst die Schuld, sondern die mangelnde medizinische Betreuung.«
Ich habe recht, ging es Andrés durch den Kopf, ich habe recht … ganz gleich, was er sagt, er gibt mir die Schuld.
Die Erkenntnis schmerzte nicht, vielleicht, weil sie für ihn nicht neu war, obwohl er sie zum ersten Mal aussprach.
»Die mangelnde medizinische Betreuung also«, murmelte er. »Soso. Die du dir damals nicht hast leisten können. Aber deswegen müsstest du die Reichen hassen, müsstest für mehr Gerechtigkeit kämpfen, müsstest dich für die Armen und die Mittelschicht einsetzen. Du müsstest ein eigenes Krankenhaus allein aus einem Grund anstreben: um die medizinische Versorgung selbst der Armen zu gewährleisten! Aber dafür hast du nie gekämpft. Du willst zu ihnen gehören, du willst so sein wie sie! Warum? Warum bist du nicht wie Victoria Hoffmann, die Rebellin, die sich auflehnt, anstatt zu buckeln?«
Ein Ausdruck der Verwirrung erschien in Ramiros Gesicht. Erst jetzt merkte Andrés, dass er geschrien hatte, wie er noch nie mit seinem Vater geschrien hatte.
Kurz keimte Hoffnung in ihm auf – Hoffnung auf ein Bekenntnis, das der Vater ihm immer verweigert hatte: weil ich dich liebe, weil ich das beste Leben für dich haben will, weil meine Gefühle und meine Prinzipien nichts zählen, solange es um dein Wohl geht, weil ich will, dass du noch mehr erreichst als ich.
Stattdessen wurde seine Miene starr und ausdruckslos. »Wenn man rebelliert«, erklärte Ramiro nüchtern, »dann darf man die Gosse nicht fürchten.«
Er fügte nichts hinzu, aber Andrés wusste – Ramiro fürchtete diese Gosse. Und er selbst auch. Neben dem Sezieren von Leichen gab es zu viele Dinge, die er gerne tat. Mit Tiago Auto fahren. Mit Tiago die Oper besuchen. Mit Tiago dinieren.
»Ich kann mich nicht mit ihm versöhnen«, wandte er dennoch ein. »Tiago ist gestern in den Norden gereist. Zu einer der Kupferminen seines Vaters.«
Ramiro hatte sich von ihm abgewandt. »Warte nicht auf seine Rückkehr. Wenn du eine Versöhnung zu lange aufschiebst, ist es vielleicht zu spät. Reise ihm nach.«
Er blieb abgewandt stehen, aber er hob die Hand und legte sie auf Andrés’ Schultern, bestärkend, ermutigend … und einschüchternd.
»Wenn du das willst«, murmelte Andrés kraftlos, »werde ich es tun.«
Victoria blätterte in der Zeitung – eine mechanische Bewegung, kein Zeichen von Neugierde, sondern lediglich eines von dem festen Willen, sich nicht ganz aufzugeben. Sie las kaum ein Wort von dem, was auf den Seiten stand. Immerhin war sie nicht länger im Bett liegen geblieben, sondern war aufgestanden, hatte etwas gegessen und versuchte nun den Anschein zu geben, wieder in den Alltag
Weitere Kostenlose Bücher