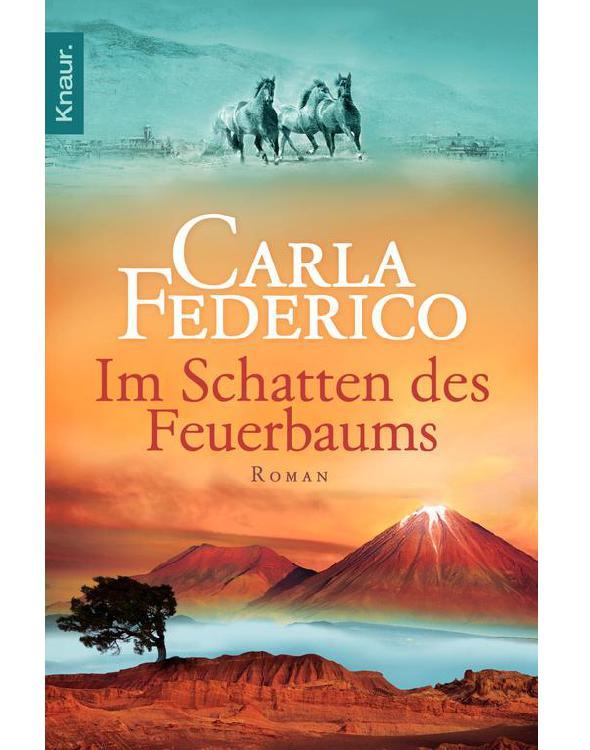![Im Schatten des Feuerbaums: Roman]()
Im Schatten des Feuerbaums: Roman
gegenübertreten. Wäre er hier, so war sie sich sicher, hätte das Hausmädchen ihm bereits Bescheid gegeben. So aber blieb dieses steif an der Haustür stehen, während sich Aurelia Stufe für Stufe hochkämpfte, immer wieder stehen blieb, hustete, nach Luft schnappte.
Im ersten Stock waren alle Vorhänge zugezogen, und diese Finsternis war wohltuend. Die Schmerzen in den Augen ließen nach, und kurz glaubte sie, befreiter atmen zu können. Am finstersten von allen Räumen war das Labor. Sie konnte sich noch gut daran erinnern, wo es sich befand. Sie klopfte an der Tür und trat ein, als niemand ihr antwortete. Anfangs hielt sie den Raum für leer: Zumindest saß niemand hinter dem Tisch, auf dem ein merkwürdiges Gebilde stand, das man Mikroskop nannte. Allerdings fiel das graue Licht nicht bis in den letzten Winkel – vielleicht verbarg sich Andrés dort.
Ein scharfer Geruch lag in der Luft. Nach einem Desinfektionsmittel, das sie einst manchmal an Victoria gerochen hatte, wenn sie aus dem Krankenhaus kam. Und nach … Branntwein.
»Andrés?«
Nur den Namen auszusprechen löste einen neuen Hustenanfall aus. Als die krächzenden, gequälten Laute verstummt waren, hörte sie ein Stöhnen, das nicht aus ihrer Brust kam. Sie trat in den Raum, fühlte, wie die Augen sich an das trübe Licht gewöhnten, und nahm dort hinten in der Ecke eine gekrümmte Gestalt wahr.
»Andrés … was ist passiert?« Sein Anblick entsetzte sie so sehr, das sie für einen Moment nicht an die eigenen Schmerzen dachte. Er hockte dort wie ein Kind, das sich vor etwas fürchtet: den Kopf ganz dicht an die Knie gezogen. Als er unendlich langsam das Gesicht hob, sah sie, dass es aufgeschwemmt und schweißnass war, die Augen rot unterlaufen, die Ringe darunter fast schwarz.
»Es wird nicht besser«, lallte er, »es wird einfach nicht besser …«
Nicht weit von ihm entfernt stand eine Lampe. Sie machte sie an und stieß dabei gegen einige Flaschen, die über den Boden rollten. Drei waren es insgesamt – er musste erst heute Morgen den Inhalt von allen getrunken haben. Der Gestank setzte ihr zu, aber noch mehr der Schwindel, der sie packte. Ob sie wollte oder nicht – sie konnte gar nicht anders, als sich neben ihm auf den Boden sinken zu lassen.
»Was wird nicht besser?«, stieß sie unter Husten hervor.
Als er zu sprechen begann, dachte sie noch, dass er die Trauer um Tiago meinte. Doch mit jedem Wort, das er stotterte, wurde seine Rede wirrer.
»Das Problem ist, dass wir an unserem Elend immer anderen Menschen die Schuld geben. Das ist ein Fehler. Mein Vater zum Beispiel hat mich nie geliebt – und ich habe stets gedacht, dass es daran liegt, weil meine Mutter bei meiner Geburt gestorben ist. Aber heute denke ich mir: Wenn er sie wirklich geliebt hätte, hätte er öfter von ihr gesprochen, hätte mehr Bilder von ihr aufbewahrt, ihre Kleidung und ihren Schmuck. Das hat er nicht – weil er sie nicht geliebt hat, zumindest nicht, als sie noch lebte. Er brauchte ihren Tod nur als Ausrede, weil er mit mir nichts anfangen konnte und es ihm eine Last war, allein ein kleines Kind großzuziehen. Wir nutzen alle Ausreden, um nicht glücklich sein zu müssen …«
Seine Worte gingen in ein Rauschen über. In ihrem Mund schmeckte es plötzlich metallisch. Gaukelte ihr der Branntweingestank das nur vor, oder hustete sie inzwischen etwa Blut?
»Andrés, ich brauche deine Hilfe …«
Er schien sie gar nicht zu hören. »Mein Leben lang habe ich Tiago glühend beneidet … Ihn zu beobachten war, als würde ich mir einen spitzen Dorn immer tiefer in die Haut treiben. Irgendwann habe ich geglaubt, es wäre alles leichter, wenn es ihn nicht mehr gibt und ich mich nicht mehr an ihm messen muss. Aber nun, da er tot ist, ist mir alles vergällt. Es gibt nichts, was mir noch Freude macht.«
»Andrés … bitte … Ich musste fliehen … Ich bin krank … sehr krank!« Sie fragte sich, wie lange sie noch die Kraft hatte, aufrecht neben ihm zu sitzen.
»Wir sind alle krank«, erwiderte er lallend, »wir sind krank vor Gier, immer noch mehr zu wollen. Mein Vater will zur Oberschicht gehören, und die, die bereits dazugehören wie William, wollen noch mehr Geld, und die, die genug Geld haben, wollen mehr Glück. Du wiederum hast all das gehabt, Geld und Ansehen und Glück. Aber deinen Frieden hast du dennoch nicht gefunden.«
Sie wollte etwas sagen, konnte jedoch nicht. Warum sah er nicht, in welchem erbarmungswürdigen Zustand sie
Weitere Kostenlose Bücher