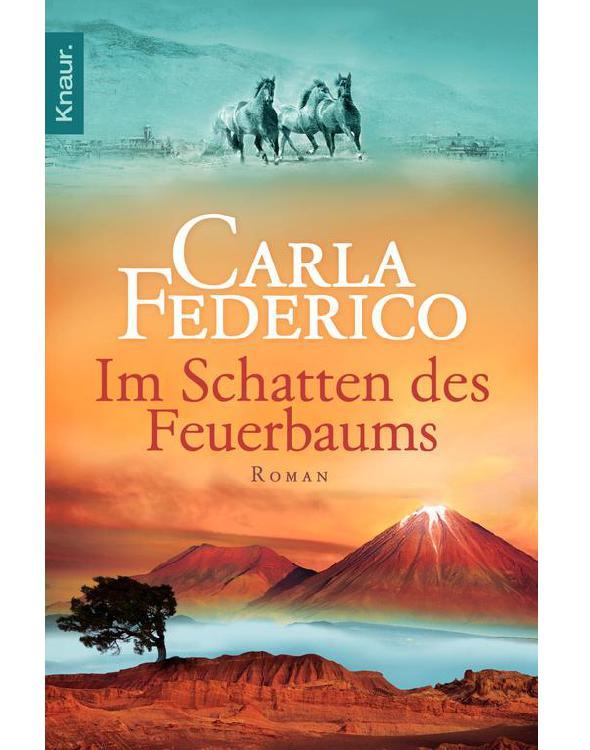![Im Schatten des Feuerbaums: Roman]()
Im Schatten des Feuerbaums: Roman
Missverständnis … Ich war traurig, und Andrés hat versucht, mich zu trösten. Von außen mag es so ausgesehen haben, als ob …«
Ihre Worte erweichten Tiago, auch wenn er nicht wusste, was sie zu dieser Lüge bewog: der Wunsch, ihn zu schonen oder nicht alles noch schlimmer zu machen, für ihn, für Andrés, für sich selbst. So oder so – es überkam ihn das gleiche Gefühl wie einst im Elternhaus: der Zwang, sie zu schützen und sie aus vermeintlich vergifteter Atmosphäre zu befreien.
»Ich bedanke mich für deine Gastfreundschaft«, erklärte er vermeintlich gefasst, »aber wir gehen.«
Espinoza verspürte sichtliche Wut auf seinen Sohn – die Röte auf seinen Wangen verriet es. Doch er achtete nicht auf Andrés, sondern trat auf Tiago zu, um dieselbe Frage wie der Sohn zu stellen: »Und wohin?«
Die Wahrheit war, dass Tiago keine Ahnung hatte. Er hatte ein paar Freunde von der Escuela, und dann gab es natürlich diverse Verwandte seiner Familie, allesamt reich wie die Brown y Alvarados’ und darum in der Lage, Gäste aufzunehmen. Allerdings standen sie gewiss auf Williams Seite. Der Oberschicht wurde oft vorgeworfen, dass sie gierig, unmoralisch und dekadent sei, dennoch gab es Gesetze, die niemand brach: Eines lautete, dass ein Sohn nicht gegen den Willen seiner Eltern heiratete. Und ein anderes, dass man zusammenhielt und sich nicht gegenseitig in den Rücken fiel.
Tiago wollte jedoch nicht zeigen, wie unsicher er sich fühlte. Erst presste er die Lippen zusammen, dann wollte er verkünden, dass es nicht Espinozas Sorge sein müsste.
Noch ehe er ein Wort hervorbrachte, vernahm er ein lautes Schluchzen. Verwirrt drehte er sich um, um festzustellen, dass es nicht, wie gedacht, aus Aurelias Mund kam. Die starrte ihn nur verwirrt an – das Weinen hingegen ertönte von der Haustür her. Und es kam ihm irgendwie bekannt vor.
Tiago ließ Aurelia, Ramiro und Andrés einfach stehen und stürzte die Treppe hinunter, um überrascht zu sehen, wem da das Hausmädchen aufgemacht hatte – und wer da herzerweichend schluchzte.
»Saqui?«, rief er überrascht.
Die Nana hob die verquollenen Augen. Ihre Haare, sonst von einer weißen Haube bedeckt, standen wirr vom Kopf ab. Noch vor einer knappen Stunde hatte er mit ihr gesprochen, und obwohl sie sich um sein Wohlergehen sorgte, hatte sie bei ihrem Abschied doch gefasst gewirkt.
»O Chico, Chico!«, rief sie jetzt ein ums andere Mal. Mein Bub …
So hatte sie ihn früher genannt, in seiner Kindheit; später hatte sie es jedoch nicht mehr gewagt. Dass sie nun zu dieser Koseform griff, zeigte, wie aufgelöst sie war.
»Ich bin den ganzen Weg hierher gelaufen«, stammelte sie unter Keuchen.
»Was ist passiert?«
Sie weinte immer heftiger. »Etwas Schreckliches …«, stieß sie hervor, »etwas ganz Schreckliches … Der Chico muss sofort nach Hause kommen.«
Victoria stand nun schon seit Stunden an der Druckerpresse, und ihr Rücken schmerzte inzwischen. Für gewöhnlich wollte sie sich solche Zeichen von Schwäche nicht zugestehen, aber an diesem Tag fiel ihr die Arbeit schwerer als sonst, da sie schon während der ganzen Woche fast immer hatte stehen müssen: Im Krankenhaus lernten sie zurzeit die Arbeit im Operationszimmer kennen. Die Schwestern mussten die Patienten vorbereiten, indem sie sie badeten und rasierten, dann galt es, alles für die Operation zurechtzulegen, unter anderem die Instrumente und die Verbandsstoffe. Und schließlich konnten sie – wenn auch aus einiger Distanz – bei der Operation zusehen. Victoria war begeistert davon – selten hatte sie so viel Neues über Hygiene und Desinfektion gelernt wie in dieser Woche. Doch die Erschöpfung, die heute auf ihren Schultern lastete, war der Preis, den sie dafür bezahlen musste.
Rebeca teilte diese Müdigkeit nicht – zum einen war sie nicht im Operationssaal zum Einsatz gekommen, zum anderen überließ sie es Victoria, die Flugblätter zu vervielfältigen, während sie sich selbst einfach auf den Schreibtisch gesetzt hatte und ihre Füße herunterbaumeln ließ.
»Sauberkeit ist so wichtig«, berichtete Victoria von dem, was sie gelernt hatte, »besonders für die schwangeren Frauen! Es wird noch viel zu wenig für sie getan. Schon seit Jahren empfehlen die Ärzte, dass sie vor und nach der Geburt vierzig Tage nicht arbeiten sollen, aber es gibt noch kein Gesetz, das diese Regelung verbindlich vorschreibt. Und es gibt auch noch viel zu wenige weibliche Lehrerinnen in
Weitere Kostenlose Bücher