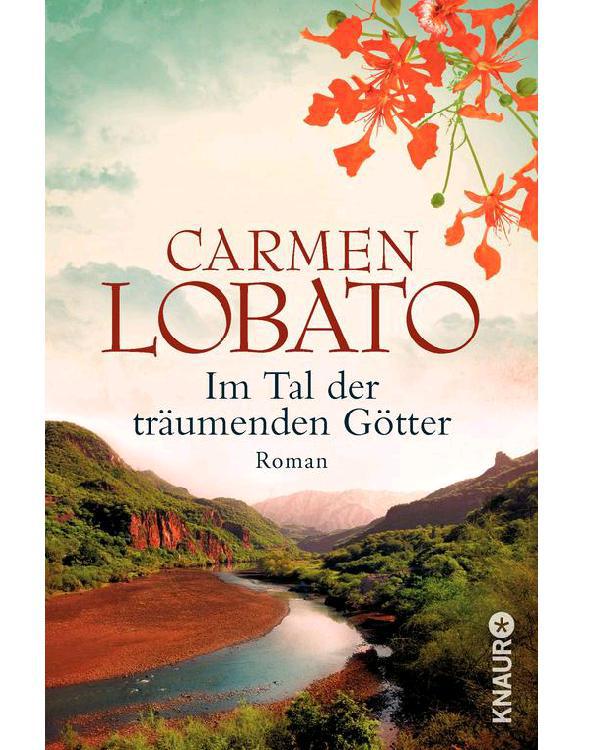![Im Tal der träumenden Götter: Roman (German Edition)]()
Im Tal der träumenden Götter: Roman (German Edition)
dann. »Wie ich sehe, kann man es überleben.«
»Versuchen Sie bloß nicht zu leugnen, dass Sie mehr wollen«, sagte Anavera und hielt ihm das Päckchen mit den Kernen hin. Sein halbes Lächeln, als er danach griff, wirkte beinahe verlegen.
»Sie müssen sie eintauchen.«
Er schüttelte den Kopf.
»Mögen Sie keine Kichererbsen? Alle Welt mag Kichererbsen!«
Jäh senkte er den Blick wie ihr Vater, wenn er sich für etwas schämte. »Ich mag das Mus nicht an meinen Fingern haben«, murmelte er. »Die Vorstellung ist mir widerlich.«
Um ein Haar hätte Anavera lauthals herausgelacht. Dann besann sie sich eines Besseren, stand auf und fand in dem Fach des Koffers, aus dem er den Becher geholt hatte, einen silbernen Löffel. Wortlos hielt sie ihm den hin. Er sah auf, und ihre Blicke trafen sich.
»Danke.«
Sie schüttelte den Kopf und wandte sich ab, damit er essen konnte, ohne sich beobachtet zu fühlen. Eine Weile schwiegen sie. Die Luft, die das Atmen schwermachte, schien sich ein wenig aufzufrischen, und der Wein besänftigte die hochgepeitschten Sinne.
»Warum streiten wir uns eigentlich nicht?«, entfuhr es ihm.
Die Frage war gut. Anavera überlegte. »Weil wir hier fremd sind«, vermutete sie. »Weil es in der Fremde guttut, wenigstens eine vertraute Stimme zu hören, die nicht schimpft.«
»Ich bin überall fremd«, sagte er.
»In Spanien auch?«
Er zögerte. »Ja«, sagte er dann, »in Spanien auch.«
Sie schenkte Wein in den leeren Becher und reichte ihn diesmal ihm zuerst. »Bei dem nicht, oder?«
Das Licht der Kerze, das auf seinem Gesicht tanzte, nahm seinen Zügen die Härte. »Nein«, sagte er und trank.
»Darf ich Sie noch etwas fragen?«
»Fragen Sie schon, ich muss ja nicht antworten.«
»Warum nennen Sie meinen Vater einen Barbaren?«
Aufrichtig erstaunt blickte er auf. »Tun das denn nicht alle? Vielleicht tuscheln sie es aus Höflichkeit hinter vorgehaltener Hand, aber die ändert ja nichts daran, dass zwischen den Angehörigen der zivilisierten europäischen Völker und den kulturlosen Ureinwohnern Welten liegen. Ich weigere mich lediglich, mich in solche Höflichkeit, die in meinen Augen Heuchelei ist, zwingen zu lassen.«
»Das meinte ich nicht«, erwiderte Anavera. »Danach, warum Sie meinen Vater beleidigen, brauche ich Sie nicht zu fragen. Das weiß ich selbst, und mein Vater hat von klein auf gelernt, damit umzugehen. Aber es ist die falsche Beleidigung. Man nennt einen Indio einen Wilden, selbst wenn er zwei Universitätsabschlüsse und einen Doktorgrad vorzuweisen hat. Ein Barbar dagegen ist ein Mann, der nicht Griechisch spricht.«
»Wie bitte?«
»Das Wort Barbaros ist griechisch«, erklärte Anavera. »Es bedeutet Fremder, und die Griechen der Antike bezeichneten so alle Leute, die nicht ihre Sprache, sondern ein ihnen unverständliches Kauderwelsch sprachen.«
»Woher wissen Sie das?«, stieß er verdattert heraus.
»Von meinem Vater«, erwiderte Anavera. »Meine Mutter sagt, er ist ein wandelnder Schwamm. Einerlei, wo er hinkommt, er saugt überall irgendetwas auf, das außer ihm kein Mensch wissen will.«
»Aber nach Griechenland wird er ja wohl kaum gekommen sein.«
Anavera lachte. »Auch wenn es Sie empört, es ist einem Wilden, den Sie Barbaren nennen, nicht verboten, die Wiege der abendländischen Kultur zu betreten. Meine Eltern waren einen ganzen Winter über in Europa. Josefa war ein Säugling. Mich haben sie von dort mitgebracht.«
Seinem Gesichtsausdruck nach hatten ihre Handvoll Worte sein gesamtes Weltbild aus den Angeln gehoben. Sie füllte den Becher nach. Als er irgendwann sprach, sah er den Wein an, nicht sie. »Mein Großvater hat alle Mexikaner Barbaren genannt«, sagte er langsam. »Er war der Ansicht, es gebe unter den hier geborenen Weißen keine reinrassigen Europäer. Einen Tropfen Indio-Blut müsse jeder haben.«
»Ist denn Ihr Vater auch in Spanien geboren?«, fragte Anavera verwundert. Sie hatte Sanchez Torrija für einen gebürtigen Mexikaner gehalten.
»Nein«, erwiderte dessen Sohn, den Blick auf die Oberfläche des Weins gesenkt. »In Mexiko. Irgendwo in einem Provinznest.«
»Dann hätte Ihr Großvater ja auch Ihren Vater für einen Barbaren mit Indio-Blut halten müssen«, entfuhr es ihr, ehe ihr klarwurde, was sie da sagte.
Er ließ den Wein im Becher kreisen und sah ihm dabei zu. »Ja, das musste er«, erwiderte er.
Sie begriff. Deshalb hatte Fernando Sentiera zu ihr gesagt, der übers Meer verfrachtete Sechsjährige sei
Weitere Kostenlose Bücher