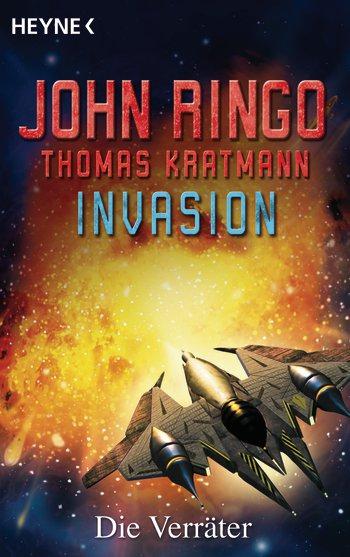![Invasion - Die Verräter - Ringo, J: Invasion - Die Verräter]()
Invasion - Die Verräter - Ringo, J: Invasion - Die Verräter
Relation zu dem Obolus, den man ihm und seiner ausgedehnten Familie wahrscheinlich für ein Asyl off-planet abverlangen würde. Dann malte er sich genüsslich die Freuden zusätzlicher fünfzig Jahre aus, in denen er nicht nur seine eigene Jugend, sondern eine schier endlose Zahl junger Frauen würde genießen können, und erklärte schlicht: »Ich werde der Legislative die entsprechenden Vorschläge machen. In zehn Tagen … versprochen.«
David, Chiriqui, Republik Panama
Das Geräusch des angestrengt arbeitenden Sauerstoffapparats wurde vom Jammern eines halben Hunderts enger Verwandter fast übertönt. Dutzende weiterer Verwandter drängten sich in den Fluren außerhalb der antiseptisch riechenden grün getünchten Intensivstation, in der Digna Miranda, winzig und einhundertzwei Jahre alt, im Begriff war, von dieser Welt in die nächste zu gleiten. Dass sie winzig war, hatte nichts mit ihrem Alter zu tun. Digna war ihr ganzes Leben lang nicht größer als einen Meter fünfundvierzig gewesen.
In dem Raum um Digna herum drängten sich die dreizehn noch lebenden Kinder von den achtzehn, die sie ausgetragen hatte, und einige von deren Nachkommen. Der Älteste war selbst siebenundachtzig, die Jüngste ein Grünschnabel von gerade achtundfünfzig. Ein Kleinkind, das man in den Raum gelassen hatte, sollte hauptsächlich Digna daran erinnern, dass ihre Nachkommenschaft gesichert war, die siebenjährige Iliana, eine Ururenkelin von Dignas’ Ältestem, Hector.
Digna selbst lag ruhig auf dem Bett. Gelegentlich gingen ihre Augen auf und wanderten über die Versammelten, soweit das möglich war, ohne dass Digna den Kopf zu drehen brauchte. Die alte Frau war dem Tode schon viel zu nahe, um zu derart athletischen Leistungen wie einer Kopfdrehung fähig zu sein.
Digna war in Panama so etwas wie eine Rarität, sie war von rein europäischer Herkunft, eine spanisch-französische Mischung mit strahlend blauen Augen. Wenn jene Augen aufgingen, waren sie immer noch hell und klar – wie auch ihr Verstand geblieben war, so sehr auch ihr Körper verfallen sein mochte. Wie schade, dachte sie, dass ich nicht in die Vergangenheit schlüpfen und einen letzten Blick auf meine Kinder als Kinder oder meinen Mann als jungen Mann werfen kann. Aber so ist das Leben … und so ist der Tod.
Obwohl ihr nicht etwa die Altersdemenz ein falsches Bild von ihrem längst verstorbenen Mann lieferte, war Dignas Verstand doch gesund genug geblieben, um selbst Bilder wachrufen zu können, Bilder, wie ihr Mann auf seinem braunen Hengst kurz nach ihrem fünfzehnten Geburtstag auf den Hof ihres Vaters geritten war, um ihn um ihre Hand zu bitten, und ein Bild von ihrem Mann, wie er aufgebahrt in seinem Sarg lag. Bis bald, Geliebter, das verspreche ich.
Der Gedanke ließ ein leichtes Lächeln über ihr Gesicht spielen, ein leichtes Lächeln, zu mehr war sie nicht mehr imstande. Das Lächeln hielt an, als ihre Augen zum Gesicht ihres Ältesten wanderten. In Blut und Schmerz habe ich dich zur Welt gebracht, mein Sohn, und nur dein Vater und eine
alte Indiohebamme haben dabei geholfen. Aber du bist zu einem prächtigen Mann herangewachsen.
Digna schloss die Augen und entschwebte in ihre Träume.
Hector seufzte und fragte sich, ob dieser Besuch im Krankenhaus wirklich der letzte bei seiner Mutter sein würde. Es schien ihm unmöglich, dass diese durch nichts gebeugte alte Frau jetzt einfach hinscheiden sollte, nachdem sie beinahe ein Jahrhundert lang alle dominiert hatte. Mit dreizehn lebenden Kindern, über hundert Enkelkindern und Ur- und Ururenkeln, die bis jetzt fast vierhundert zählten – und einem weiteren Dutzend unterwegs -, war sie wahrhaftig die Mutter einer Rasse.
» La armada Miranda.« Hector lächelte über den Familienwitz, ehe seine Stirn sich furchte. »Armada« war vielleicht in der Tat der richtige Ausdruck, selbst wenn nur die Hälfte von dem stimmte, was der Präsident gesagt hatte. Persönlich argwöhnte Hector, dass die Rede des Präsidenten wesentlich mehr als nur die halbe Wahrheit enthalten hatte. Weshalb sonst würde er die Gringos wieder ins Land zurückholen wollen?
Du gehst jetzt besser, Mutter, denke ich. Oder wenn nicht jetzt, dann bald. Du bist in einer saubereren und besseren Welt aufgewachsen. Ich möchte nicht, dass das, was aus uns werden wird, deine letzten Tage trübt.
Aus dem Korridor draußen war ein wirres und verwirrendes Murmeln zu vernehmen. Hector wandte sich vom Totenbett seiner Mutter ab und sah eine
Weitere Kostenlose Bücher