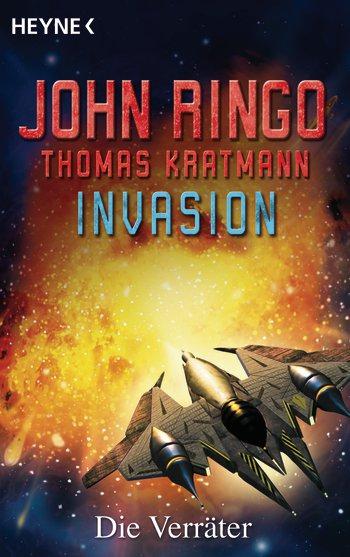![Invasion - Die Verräter - Ringo, J: Invasion - Die Verräter]()
Invasion - Die Verräter - Ringo, J: Invasion - Die Verräter
erwartete ihn in der Dusche. Das Hologramm hatte sich dafür nackt ausgezogen.
McNair scheuchte sie nicht hinaus. Er wies sie auch nicht an, eine Uniform zu projizieren, sondern sagte nur: »Ich habe dich vermisst, Daisy. Unsagbar vermisst. Ich hatte schreckliche Sorge, dich nie wiederzusehen.«
»Gefalle ich dir?«, fragte der Avatar unsicher und benutzte dabei unbewusst zum ersten Mal das vertraute Du.
McNair lachte leise. »In jeder Form und Gestalt, meine Liebe – ob nun Schiff oder Mädchen, ja, du gefällst mir.«
»Dann auf sehr bald«, antwortete der Avatar geheimnisvoll. »Sehr, sehr bald.«
Kongresspalast, Plaza de los Mártires, Panama City, Panama
Die volle Zahl der verbliebenen zweiundfünfzig Kongressmitglieder war nicht erschienen. Zwei hielten sich versteckt, was durchaus verständlich war, da zwei weitere standrechtlich erschossen worden waren.
Aber achtundvierzig sind auch genug , sinnierte Suarez. Achtundvierzig sind ein Quorum.
Jene achtundvierzig saßen auf ihren üblichen Plätzen. Mit anderen Worten, es gab in der Versammlung große und unübersehbare Lücken. Suarez hatte darüber nachgedacht und dann entschieden, dass die leeren Plätze sich vielleicht ganz gut als Hinweis an die Abgeordneten eignen würden, dass er
es mit dem, was er von ihnen wollte, todernst meinte. Der Ring aus bewaffneten Soldaten – mit Helm, strenger Miene und in Battle Dress höchst beeindruckend – trug nur dazu bei, diese Wahrnehmung zu verstärken.
Suarez trug ebenfalls Battle Dress, aber keinen Helm, und seine einzige Waffe, die Pistole, steckte gesichert im Halfter. Da er einen Arm in der Schlinge trug und die dazugehörige Schulter dick bandagiert war, war die Pistole auch eher Symbol denn eine Waffe.
Er verzichtete auf jegliche Theatralik, schlug auch nicht mit einer Machete – noch viel weniger mit der Pistole – auf sein Rednerpult, sondern tippte nur an das am Pult befestigte Mikrofon und sagte ruhig: »Wenn ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten dürfte.«
Als er sah, dass er die hatte, begann er seine Rede ohne Umschweife.
»Die Demokratie«, begann Suarez, »ist eine wunderbare Sache. Sie ist ein Mittel zum Machtwechsel und eignet sich dazu, ohne Blutvergießen eine neue Politik festzulegen, ohne dabei den Staat in Stücke zu reißen.«
Er legte eine kurze Pause ein und fuhr dann fort: »Das soll heißen, dass Demokratie gut sein kann . Sie ist das nicht immer. Manchmal dienen Wahlen nur dazu, eine bestechliche und durch und durch korrupte Kabale nach der anderen mit dem Gütesiegel der Rechtmäßigkeit zu versehen. Manchmal, nein – ich nehme das zurück … hier in Panama haben wir das immer wieder erlebt. Der einzige Unterschied zwischen einer Partei und der nächsten besteht darin, von wem sie stiehlt und was sie stiehlt.
Im Frieden ist das erträglich. Es ist sogar der anderen Methode vorzuziehen, die wir kennengelernt haben, nämlich der Herrschaft durch Soldaten, die nicht nur Geld stehlen, sondern auch die Freiheit. Im Frieden würde ich – und Sie würden das auch – die Korruption eines Presidente Mercedes hundert Mal der korrupten Tyrannei eines Noriega vorziehen.«
Suarez sprach ohne die Stimme anzuheben, aber man konnte jetzt den Ekel aus seinem Tonfall heraushören. »Aber das gilt für Friedenszeiten. Und wir haben keinen Frieden.«
Er deutete mit einer Kinnbewegung auf zwei bewaffnete Wachen im hinteren Teil des Saals und befahl: »Bringen Sie den Gefangenen herein.« Er redete weiter, während die Wachen kehrtmachten und den Saal verließen, wobei sie die zwei Türflügel offen stehen ließen. »Wir haben nicht Frieden. Wir wollen keine Tyrannei. Und Korruption, Verrat und Feigheit, wie sie das Regime Mercedes an den Tag gelegt hatten, können wir nicht länger ertragen. Was sollen wir also tun?«, fragte er, als würde er überlegen. »Was sollen wir tun?«
Der Colonel verstummte und wartete, während die Wachen zurückkehrten und William Young Boyd durch den Mittelgang zu ihm führten. Boyds Hände steckten in Handschellen, aber seine Beine waren frei. Er trug keine Uniform, vielmehr eine guayabera mit offenem Kragen, ein besticktes Hemd mit kurzen Ärmeln, wie man es im tropenheißen Panama anstelle von Anzug und Krawatte zu tragen pflegte.
Die Wachen drehten Boyd herum, sodass er den Abgeordneten das Gesicht zuwandte, und nahmen dann beiderseits von ihm Haltung an. Boyd blickte unbesorgt, aber keineswegs froh.
»Wir sind Latinos«, sagte Suarez. »Das bedeutet,
Weitere Kostenlose Bücher