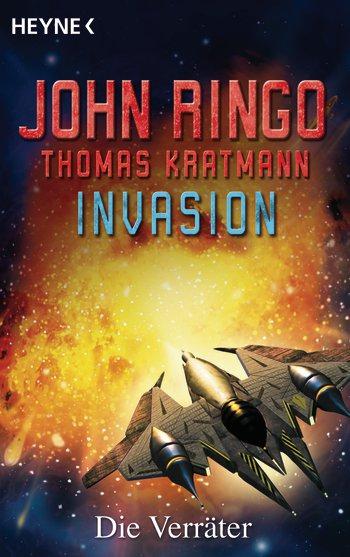![Invasion - Die Verräter - Ringo, J: Invasion - Die Verräter]()
Invasion - Die Verräter - Ringo, J: Invasion - Die Verräter
»Du hättest doch einen Aufschub bekommen können. Wenn dein Vater das nicht arrangiert hätte, hätte meiner es getan.«
Julio starrte auf den Ventilator an der Decke. Wie kann ich ihr erklären, dass ich mich für sie freiwillig gemeldet habe? Wie erkläre ich ihr, dass ich mir beim Rasieren im Spiegel nicht mehr hätte in die Augen sehen können, wenn ich es anderen überlassen hätte, das für mich zu tun?
Aber statt es ihr zu erklären, meinte Julio nur: »Mein Vater würde niemals so etwas tun. Und dein Vater würde dich grün und blau schlagen, wenn er wüsste, dass wir einander sehen.« Julio seufzte, ehe er fortfuhr: »Und ich könnte es nicht. Ich könnte es einfach nicht. Es wäre nicht richtig.«
Die siebzehnjährige Paloma stemmte sich von seiner Schulter hoch, nahm Julios Hand und legte sie auf ihre Brust. »Es wäre nicht richtig , wenn du für mich hier bleiben würdest? Es wäre nicht richtig , dass du mich so hältst? Ich … ich habe noch nie etwas so Selbstsüchtiges gehört!«
Sie stieß seine Hand weg und stand auf, und ihre Augen blitzten zornig. Paloma ging um das Bett herum, hob wütend ihre Kleider vom Boden auf und zog sie schnell an, ihren BH stopfte sie einfach bloß in ihre Handtasche, ließ ihre Brüste frei wippen, wie um Julio daran zu erinnern, was er für diese dickköpfige Entscheidung aufgab, dafür, dass er seine Augen vor der Wahrheit verschloss, dass dieser Krieg nämlich nur für die Ameisen im Lande geführt wurde und dass die besseren Leute sich da heraushalten sollten.
Aber so wütend sie war, vielleicht gerade weil sie jetzt so wütend war, hielt Julio sie immer noch für das Schönste, was er je gesehen hatte. Eine Figur wie ein Stundenglas, eine aristokratische Nase, leuchtende grüne Augen … Seufz . Er versuchte aufzustehen, um sie aufzuhalten, aber sie hob abwehrend die Hand.
»Wenn du wieder bei Sinnen bist und dich entschieden hast, dass ich das Wichtigste bin, was es in deinem Leben gibt, dann ruf mich an. Und bis dahin will ich dich weder sehen noch von dir hören.«
Ohne ein weiteres Wort machte sie auf dem Absatz kehrt, verließ das Zimmer und knallte die Tür hinter sich zu.
Quarry Heights, Panama City, Panama
Als Digna Miranda sich in Boyds spartanisch eingerichtetem Büro in einer der Behelfsbauten auf dem wie von Waben durchzogenen Hügel meldete, salutierte sie, wie man es ihr beigebracht hatte. Er hätte sein Arbeitszimmer opulent einrichten können, aber sein angeborener Sinn für Sparsamkeit ließ das einfach nicht zu.
Boyd erwiderte die Ehrenbezeigung ungeschickt, ehe er den kleinwüchsigen Lieutenant höflich bat, Platz zu nehmen. Obwohl sie sich bereit erklärt hatte, ihn aufzusuchen – wahrscheinlich hätte sie es gar nicht ablehnen können -, war Digna argwöhnisch. Sie hatte nur wenige Illusionen. Sie wusste, dass sie gelinde gesagt umwerfend aussah, und weshalb dieser jung-alte General sie unter vier Augen sprechen wollte, wusste sie nicht, war aber argwöhnisch. Man musste allen Männern misstrauen, insbesondere engen Blutsverwandten, bis sie sich als vertrauenswürdig erwiesen hatten.
Sie nahm weisungsgemäß Platz. Boyd bemerkte, dass sie die Augen argwöhnisch zusammengekniffen hatte.
»Lieutenant Miranda, dieses Gespräch ist nicht das, was Sie vielleicht glauben«, sagte er verlegen.
»Na gut«, antwortete sie, ohne dass ihre Miene sich veränderte, »was ist es dann?«
»Sie haben bei dem Empfang in Fort Espinar etwas gesagt, was mich neugierig gemacht hat. Sie haben sich über die ›verweichlichten Stadtjungs‹ beklagt, die wir zu Offizieren machen. Ich wollte, dass Sie mir das erklären.«
»Oh«, sagte Digna, der ihr Argwohn plötzlich peinlich war. »Also, die sind weich, obwohl die Gringos sich alle Mühe geben, sie hart zu machen. Sie wissen nicht, was es bedeutet, unter schwierigen Bedingungen zu leben. Schmerz ist für sie ein Fremdwort. Und was vielleicht das Schlimmste ist: Sie verfügen nicht über die selbstlose Loyalität, die es braucht.«
»Und sie sind alle so?«, fragte Boyd.
Sie überlegte einen Augenblick, gab sich alle Mühe, fair zu sein. »Nein … nicht alle. Bloß viel zu viele.«
»Sie meinen, das könnte ein Problem für uns werden?«
»Ein sehr ernstes Problem sogar«, erwiderte sie und nickte.
Boyd stellte die wichtige Frage mit all dem Ernst, den sie erforderte. »Was können wir dagegen tun?«
»Wir brauchen nicht so viele Offiziere, wie wir geschaffen haben. Keine Kompanie mit
Weitere Kostenlose Bücher