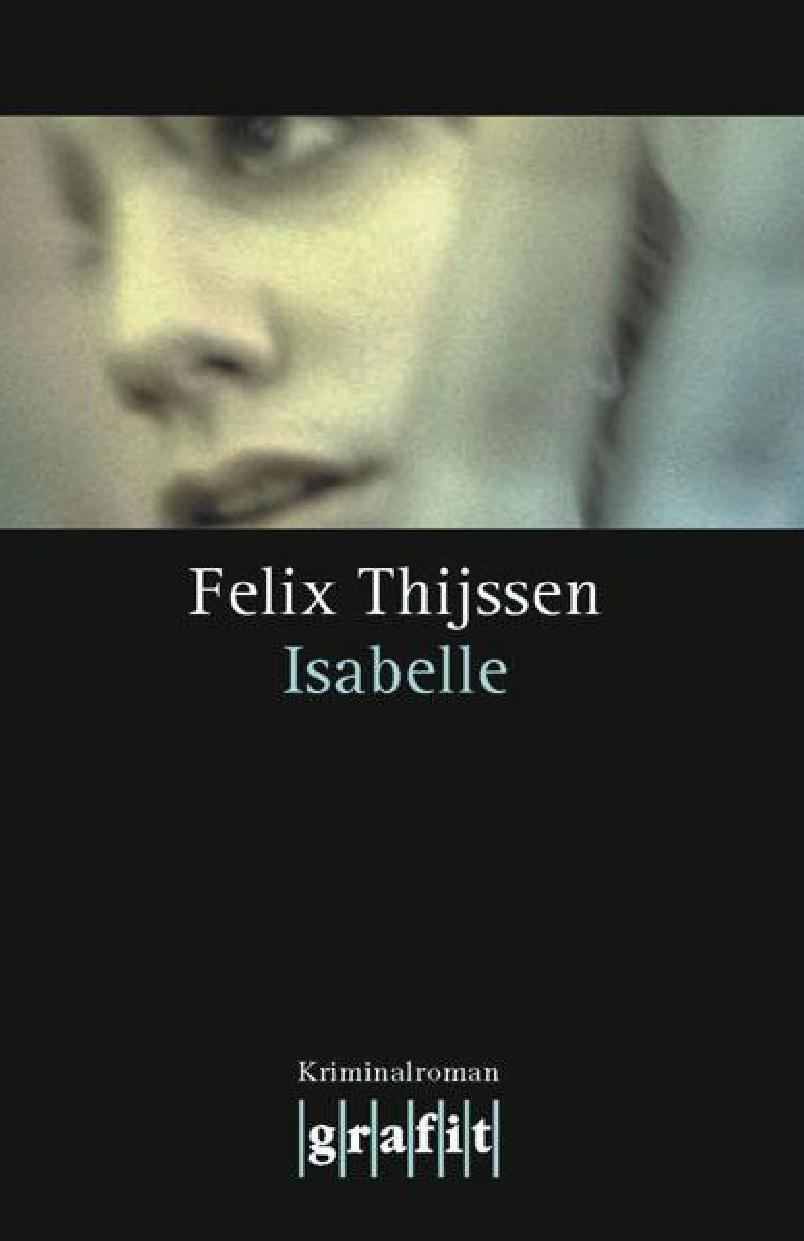![Isabelle]()
Isabelle
abholt.«
»Einen Wagen?«, fragte Maran erschrocken. »Aber was ist denn passiert? Ist sie tot?«
»Nein, Mevrouw, sie liegt im Krankenhaus, sie ist ver letzt, aber nicht schwer, sie schwebt zumindest nicht in Lebensgefahr. Können wir Sie denn jetzt abholen lassen?«
»Ja, bitte«, antwortete Maran verwirrt und legte den Hörer auf die Gabel. Mühsam erhob sie sich aus ihrem Stuhl mit der geraden Rückenlehne. Sie hielt nach der Häkelnadel Ausschau, konnte sie aber nirgends entde cken. Vielleicht war sie unter den Tisch gefallen.
Mit steifen Gliedern ging sie in den Flur und strich vor dem altmodischen Spiegel mit einer Bürste über ihr grau es Haar. Sie zog die Schublade darunter auf und holte ein graues hauchdünnes Tuch heraus, das sie sich um den Hals wickelte und im Kragen ihres dunkelblauen Kleides feststeckte. Sie entschied sich für den grauen Mantel und setzte vorsichtig ihren Filzhut auf. Als sie zurücktrat und in den Spiegel schaute, erkannte sie, dass sie wie zum Kirchgang gekleidet war.
Kleiweg sah die rüstige alte Dame am Arm einer Polizis tin in Zivil über den Flur des Krankenhauses kommen. Sie sah aus wie eine Dorfausgabe von Königin Elizabeth.
»Mevrouw Mertens?«
Die Dame ließ den Arm der Beamtin los und blieb ste hen. »Ich bin die Tante von Isabelle. Sind Sie der behandelnde Arzt?«
Kleiweg reichte ihr die Hand. »Inspecteur Kleiweg, Kriminalpolizei.«
Bei dem Wort »Kriminalpolizei« ließ sie sofort seine Hand los. Stirnrunzelnd wandte sie sich an die Beamtin, die neben ihr stand. »Ich dachte, sie hatte einen Unfall?«
»Jetzt lassen Sie uns doch erst einmal feststellen, ob es sich tatsächlich um Ihre Nichte handelt«, schlug Kleiweg vor. »Bitte kommen Sie kurz mit mir.« Er drehte sich um und öffnete ein paar Schritte weiter eine Tür. Er nickte der Polizistin zu, die bei ihrem Kollegen draußen auf dem Flur blieb, und folgte der alten Dame ins Krankenzimmer.
Tante Maran blieb erschrocken stehen, als sie Isabelle an Schläuche und Monitore angeschlossen im Bett liegen sah, bis hoch zum Kinn mit einem Laken bedeckt, sodass ihre verbundene Schulter nicht zu sehen war. Isabelle hatte die Augen geschlossen, und Maran konnte nicht erkennen, ob ihre Nichte von selbst atmete oder ob sie künstlich beatmet wurde. Ihr Gesicht war blutleer, aufgedunsen und teigig.
»O mein Gott«, seufzte Tante Maran. Sie trat nach vorn, weil sie dachte, dass man von ihr erwartete, ihre Nichte zumindest einmal zu berühren, war aber froh, als Kleiweg sie am Arm zurückhielt.
»Sie kann sie nicht hören«, sagte der Inspecteur.
Tante Maran schaute ihn entsetzt an. »Was ist denn passiert?«
»Ihre Nichte hat Glück gehabt. Sie schwebt nicht in Lebensgefahr und wird wieder ganz gesund werden.« Er warf einen Blick auf Isabelle und sagte in gedämpftem Ton: »Bitte kommen Sie mit auf den Flur. Sie liegt zwar im Koma, aber man sagt, dass manche Komapatienten trotz ihres Zustands genau hören können, was …«
»Im Koma?«, unterbrach sie ihn.
Er geleitete sie höflich zurück in den Flur und zog die Tür hinter sich zu. Ein paar Meter weiter unterhielt sich die Beamtin mit einer Krankenschwester.
Kleiweg erklärte, was passiert war. Tante Maran hörte ihm mit unbewegtem Gesicht zu. »Ich kann das einfach nicht verstehen«, sagte sie. »Isabelle hat mich gestern Abend noch angerufen und gesagt, sie sei mit einem Freund essen gegangen und es könne spät werden.« Verwirrt schwieg sie. »So etwas würde sie normalerweise niemals tun. Ich kann das kaum fassen.«
»Sie meinen, sie würde niemals so ohne weiteres mit einem Mann auf ein Hotelzimmer gehen?«
Tante Maran biss sich auf die Lippen. Es fiel ihr schwer, über solche Dinge zu reden. »Sie hatte einmal einen Freund, bei dem hat sie auch ein Jahr lang gewohnt, Gerard hieß er. Nachdem es aus war, ist sie wieder zu mir gezogen. Sie ist wirklich nicht so eine, die … Sie wollte vor Einbruch der Dunkelheit zu Hause sein.« Maran schüttelte den Kopf.
»Sagt Ihnen der Name Ben Visser etwas?«, fragte Kleiweg.
»Ist das der Mann, der …?«
»Ja. Er ist tot.«
Wieder schüttelte sie den Kopf, jetzt entschiedener. »Ich habe diesen Namen noch nie von ihr gehört.«
»Würde sie es Ihnen erzählen, wenn sie einen Freund hätte?«
»Ich denke schon.« Sie schaute ihn an. »Eigentlich ist sie meine Großnichte. Ich habe sie aufgezogen. Ihre Mutter ist bei ihrer Geburt gestorben. Einen Vater gab es nicht. Es gab niemand anderen. Wenn ich
Weitere Kostenlose Bücher