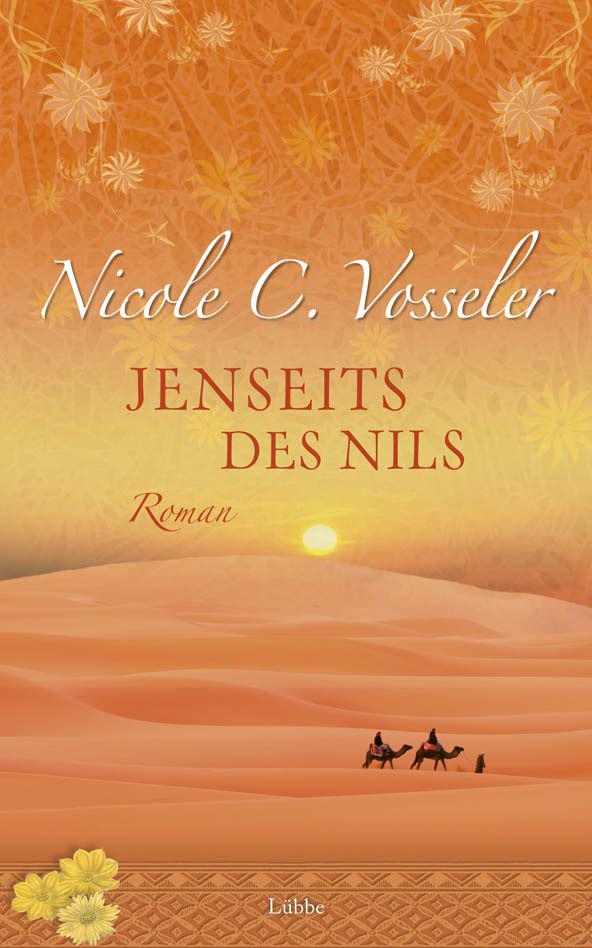![Jenseits des Nils: Roman (German Edition)]()
Jenseits des Nils: Roman (German Edition)
alle Zimmer im unteren Stockwerk nach ihm durchsucht, war sogar durch die Glastür des Salons hinausgegangen und hatte im Garten nach ihm Ausschau gehalten. Es war sein Blick gewesen, sein Blick, in dem sich eine unendliche Erschöpfung und eine wilde Entschlossenheit mischten, der ihr die letzten Male, die sie hier auf Shamley Green zu Besuch gewesen war, Beklommenheit verursacht und sich schließlich zu einer düsteren Ahnung verdichtet hatte. Und heute, da sie wusste, dass er so gut wie allein im Haus sein würde, wollte sie dem auf den Grund gehen, ihm vielleicht auch gut zureden.
Einen Raum des Hauses hatte sie bei ihrer Suche ausgespart: das Arbeitszimmer des Colonels. Für Besucher war es ohnehin tabu, aber auch Grace, Ada und Stephen durften für gewöhnlich nur mit Erlaubnis des Vaters hinein, das wusste Becky seit Kindertagen. Dieses Zimmer blieb dennoch ihre letzte Hoffnung und die einzige Möglichkeit, wo Stephen noch sein könnte. Sie legte das Ohr an die Tür und lauschte. Sie glaubte, ein leises Rascheln, ein Klicken gehört zu haben, und klopfte an das Holz. »Stevie?« Wie abgeschnitten waren die Geräusche von jenseits der Tür. »Stevie? Ich bin’s, Becky! Ich weiß, dass du da drin bist!«
»Hau ab!«
Becky atmete erleichtert auf, nahm ihren ganzen Mut zusammen und öffnete schnell die Tür, bevor er sie von innen absperren konnte.
»Hau ab, hab ich gesagt! Siehst du nicht, dass du störst?!«
Becky erschrak zutiefst. Nicht über seinen Tonfall. Sondern über die Waffe in seiner Hand, die ein Stück vor seiner Schläfe innegehalten hatte. »Nicht, Stevie. Leg das Ding weg!«
Ihre Augen weiteten sich, als sie in die Mündung des Revolverlaufs blickte, den er nun auf sie gerichtet hielt. »Hau. Jetzt. Ab.«
»Nein, Stevie.« Sie schüttelte den Kopf und machte einen Schritt auf ihn zu, sah ihm unverwandt in die Augen. »Du willstdas doch nicht. Du willst dir nicht wehtun. Und mir genauso wenig.«
»Bist du so blöd, oder tust du nur so? Geh weg, hab ich gesagt!« Der Hass in seiner Stimme wurde von Verzweiflung überlagert. »Geh weg und lass mich allein!«
Sie machte noch einen Schritt, hielt seinen Blick weiter fest. »Leg das Ding hin.«
Seine Hand zitterte kurz, und Becky ging ermutigt einen weiteren Schritt auf ihn zu.
»Du sollst weggehen!«
Stephen konnte es nicht spüren, aber er roch es, dass sich der Inhalt seiner Blase unwillkürlich in die Windel ergossen hatte, die er unter den Hosen trug. Dieser stechend scharfe Geruch, den er so hasste. Und Scham und Ekel überrollten ihn, zogen ihn hinein in ihren flammenden Schlund, als er gleich darauf auch noch den dumpfen, stickigen Geruch wahrnahm, der ihm verriet, dass sich sein Darm ebenfalls entleert hatte. Seine Hand zitterte wie ein Blatt im Wind. »Geh weg, Becky! Bitte! Tu mir den Gefallen!«
»Erst gibst du mir dieses Ding.« Noch ein Schritt. Becky wusste nicht, wie man eine solche Waffe am besten anfasste und wie sich das mit der Sicherung verhielt oder wie das hieß. Grace, ja, Grace hätte es gewusst, aber Grace war nicht hier.
Stephens Stimme verzerrte sich, wurde zu einer Klage, die hoch und dünn aus seiner Kehle kippte. »Gehwweeeegg.« Sein Unterkiefer bebte, die Mundwinkel zogen sich nach unten, und er schluchzte auf. »Gehwweeeegg.«
Becky streckte beide Hände nach dem Revolver aus; vorsichtig packte sie ihn von oben mit beiden Händen und zog ihn Stephen aus den unsicheren Fingern, erschrak darüber, wie unvermutet schwer die Waffe war. Die Mündung von ihnen beiden abgewandt, legte sie den Revolver auf den Schreibtisch, so weit weg von Stephen wie nur möglich.
Stephen schlug die Hände vors Gesicht, die überlang undknotig wirkten in ihrer Magerkeit, und weinte, wie Becky noch nie jemanden hatte weinen sehen. Und Becky hatte in ihrem Leben als Pfarrerstochter viele Menschen weinen sehen: Menschen, die einen Angehörigen oder ein Kind verloren hatten. Menschen, die sich schwer versündigt hatten oder denen Leid angetan worden war. Menschen, die nicht wussten, wo morgen ihr täglich Brot herkommen sollte, und solche, die nicht mehr lange zu leben hatten.
Stephen heulte wie ein verwundetes Tier, schlotternd und von Schluchzern durchgeschüttelt, und Tränen rannen zwischen seinen Finger hindurch und über die Handgelenke.
Becky trat näher, blieb schließlich neben dem Rollstuhl stehen. Sie streckte die Hand aus, hielt über Stephens Kopf inne, zögerte, ließ sie schließlich auf sein Haar sinken, das so
Weitere Kostenlose Bücher