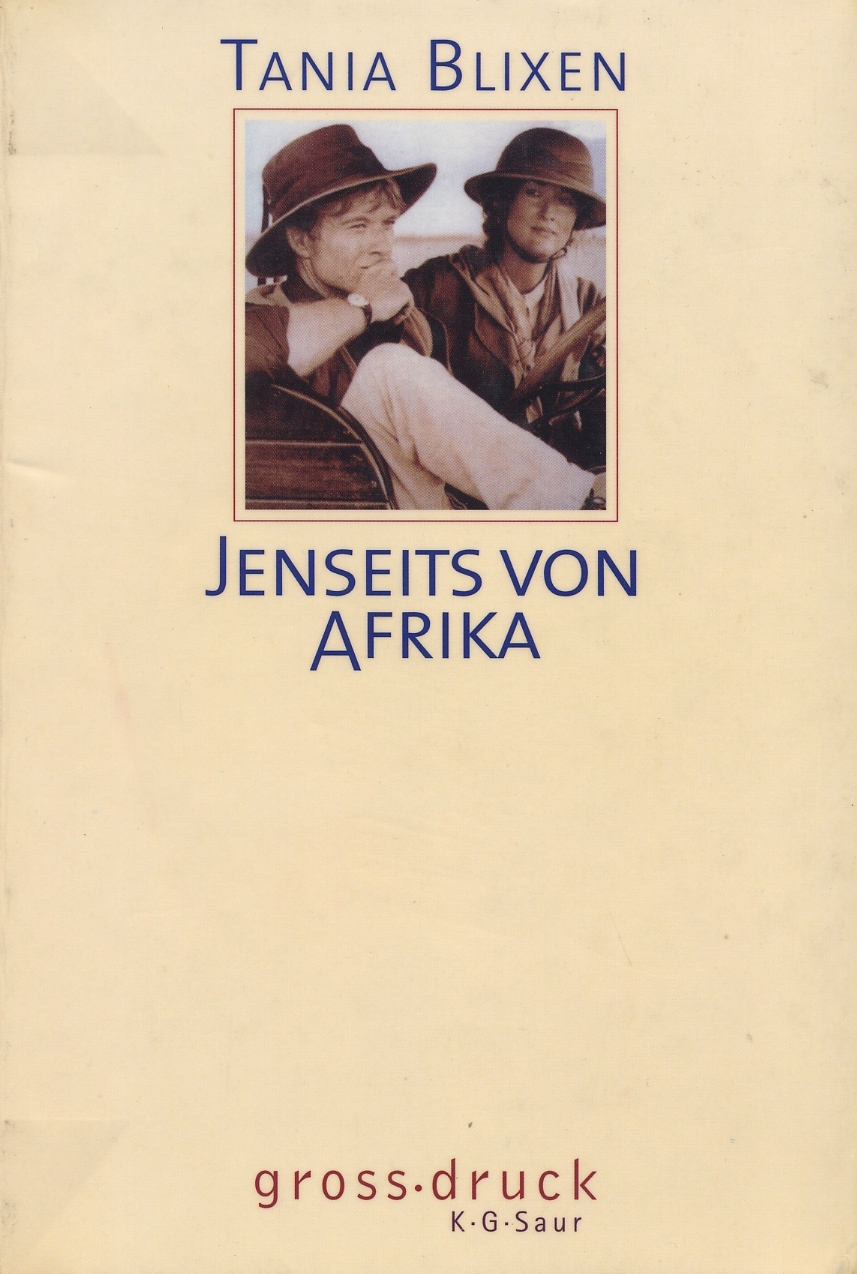![Jenseits von Afrika]()
Jenseits von Afrika
gab mir Anweisungen, vier Ochsenfuhren zu beladen und sie so rasch wie möglich hinzuschicken. Aber ich dürfe sie keinesfalls ohne Begleitung eines Weißen abgehen lassen, denn niemand wisse, wo die Deutschen steckten, und die Massai seien durch den Krieg in die größte Aufregung geraten und schwärmten überall im Reservat herum. Man vermutete damals die Deutschen überall, und wir stellten an der großen Eisenbahnbrücke in Kijabe Posten auf, um zu verhindern, daß sie in die Luft gesprengt wurde.
Ich engagierte einen jungen Südafrikaner namens Klapprott als Begleiter der Kolonne; aber als die Fuhren geladen waren, wurde er, am Abend bevor die Expedition abgehen sollte, als Deutscher verhaftet. Er war kein Deutscher und konnte es nachweisen; er wurde nach einiger Zeit aus der Haft entlassen und änderte seinen Namen. Damals aber sah ich in seiner Verhaftung einen Fingerzeig Gottes, denn nun war außer mir niemand da, der die Wagen durch die Wildnis bringen konnte. So brachen wir denn in der Frühe auf- alle Sternbilder standen noch am Himmel –, den endlos langen Kijabeberg hinunter, die weite Steppe des Massaireservats stahlgrau im matten Schein in der Morgendämmerung zu unseren Füßen, an den Wagen schaukelten die Laternen, und weithin schallten Gebrüll und Peitschenknallen. Ich hatte vier Wagen mit je einem vollen Gespann von sechzehn Ochsen und fünf Reserveochsen, dazu einundzwanzig junge Kikuju und drei Somali: Farah, den Jäger Ismail und einen alten Koch, ebenfalls Ismail genannt, einen famosen alten Mann. Mein Hund Dusk ging mir zur Seite.
Leider hatte die Polizei, als sie Klapprott verhaftete, mit ihm auch sein Maultier verhaftet. Ich hatte es in ganz Kijabe nicht auftreiben können. So war ich die ersten Tage genötigt, neben dem Wagen zu Fuß zu gehen. Später kaufte ich Maultier und Sattel bei einem Manne, der mir im Reservat begegnete.
Ich war damals drei Monate unterwegs. Als wir an unseren Bestimmungsort kamen, wurden wir sofort wieder ausgeschickt, um die Proviantvorräte einer großen amerikanischen Jagdexpedition herbeizuschaffen, die in der Nähe der Grenze ihr Lager errichtet hatte und bei der Nachricht vom Ausbruch des Krieges Hals über Kopf davongegangen war. Von da ging es wieder anderswohin. Ich kannte mich allmählich aus in den Furten und Wassertümpeln des Massaireservats und lernte, mich ein wenig auf massai zu verständigen. Die Straßen waren überall unsäglich schlecht, tief versandet und von Felsblöcken gesperrt, die oft höher waren als die Wagen; späterhin zogen wir meist über die offene Steppe. Die Luft des afrikanischen Hochlands stieg mir zu Kopfe wie Wein, ich war immer leicht trunken, und die Wonne dieser Monate war unbeschreiblich. Ich hatte schon Jagdsafaris mitgemacht, aber ich war noch nie allein mit Afrikanern ausgezogen.
Die Somali und ich, die für das Staatseigentum verantwortlich waren, lebten in dauernder Furcht, die Ochsen durch Löwen zu verlieren. Die Löwen folgten begierig den großen Nachschubtransporten von Schafen und Proviant, die sich jetzt beständig auf die Grenze zubewegten. Frühmorgens, wenn wir aufbrachen, konnten wir in den Wagenspuren der Wege lange Zeit die frischen Fährten der Löwen im Sande verfolgen. Nachts, wenn die Ochsen ausgespannt wurden, bestand immer Gefahr, daß die Löwen, die das Lager umstrichen, sie aufscheuchten, daß sie davonstoben und sich in der Wildnis verliefen, wo sie nie wiederzufinden gewesen wären. Wir bauten deshalb im Kreis um unseren Lager- und Rastplatz Hürden aus Dorngesträuch und saßen mit geladenen Gewehren um die Lagerfeuer.
Hier fühlten sich Farah und Ismail und sogar der alte Ismail in so sicherer Ferne von aller Zivilisation, daß ihre Zungen sich lösten und sie merkwürdige Erlebnisse aus Somaliland erzählten oder Geschichten aus dem Koran und aus Tausendundeiner Nacht. Farah und Ismail waren zur See gewesen; sie müssen wohl in alten Zeiten zu den großen Piraten im Roten Meer gehört haben. Sie setzten mir auseinander, daß jedes Lebewesen auf Erden sein Abbild am Grunde des Meeres habe: Pferde, Löwen, Frauen, Giraffen – alles lebt in der Tiefe und ist zuzeiten von den Seeleuten gesehen worden. Sie berichteten mir auch von Pferden, die im Somaliland am Grunde der Flüsse leben und in Vollmondnächten auf die Weiden heraufsteigen, um sich mit den Stuten der Somali zu paaren und Fohlen von wunderbarer Schönheit und Schnelligkeit zu zeugen. Die Kuppel des Nachthimmels glitt,
Weitere Kostenlose Bücher