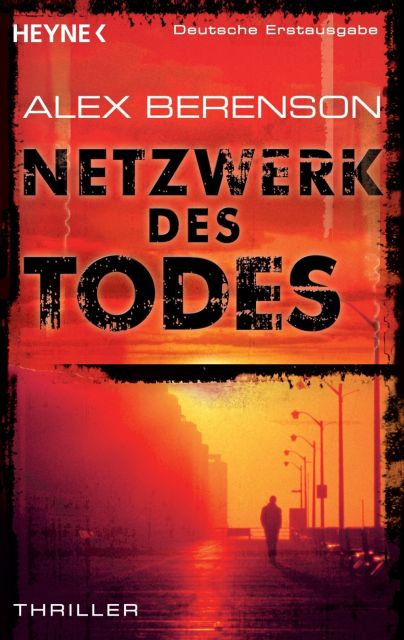![John Wells Bd. 2 - Netzwerk des Todes]()
John Wells Bd. 2 - Netzwerk des Todes
sprechen.«
»Nur ein paar Sätze, damit es später nicht heißt, wir wären ohne Erlaubnis hier gewesen. Und dann tätigen wir einige Anrufe.«
Sieben Stunden später saßen Exley, Shafer, Tyson und Wells in der Bibliothek von Tysons Haus in Falls Church. Tyson hatte ihnen versichert, dass dieser fensterlose quadratische
Raum ebenso sicher sei wie jeder in Langley. Bücher über Spionage – sowohl Tatsachenberichte als auch Romane – füllten die Regale, von Klassikern wie Der Geheimagent und Die neununddreißig Stufen bis zu den umfangreichen Bänden von Tom Clancy. Wells und Exley teilten sich ein Zweiersofa, und Exley erlaubte sich sogar, ihre Hand vertraulich auf Wells’ Bein zu legen. Zwei seidenweiche Perserkatzen schliefen in der Ecke. Tyson hätte nur noch eine Zigarre und ein Glas Whiskey gebraucht, um das Bild eines ungezwungenen Gentlemans zu vervollständigen, dachte Wells. Aber die Ruhe im Raum war trügerisch.
Nur wenige Kilometer östlich zerlegte eine FBI/CIA-Arbeitsgruppe Keith Robinsons Büro in Langley, um herauszufinden, was er im Lauf der Jahre gestohlen hatte, auf welche Datenbanken er Zugriff hatte, welche Akten er kopiert hatte und wie viele Operationen und Spione er hatte auffliegen lassen. Sollte Robinson tatsächlich am nächsten Morgen auftauchen, hätten die Agenten in seinem Büro beträchtlichen Erklärungsbedarf. Aber alle stimmten überein, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dies passierte, gleich null war.
»Ich schätze, wir haben unseren Maulwurf gefunden«, sagte Tyson. »Oder besser gesagt, er hat uns gefunden.« Er lächelte nicht. »Schlimmer könnte es gar nicht sein. Er hatte Zugang zu Informationen der höchsten Geheimhaltungsklasse. Alle Kontakte in China sind aufgeflogen, ebenso wie in Nordkorea, und vielleicht sogar in Japan und Indien. Der einzige Bereich, in den er nicht vorgedrungen ist, ist der GKGT« – der Globale Krieg gegen den Terror, der amerikanische Kampf gegen die Al-Quaida. China hat damit so wenig zu tun, dass sich die Leute gewundert hätten, wenn er zu viele Fragen gestellt hätte.«
»Außerdem glaube ich nicht, dass sich seine Freunde in Peking allzu sehr für Osama Bin Laden interessieren«, sagte Shafer.
»Wofür sie sich interessieren, wissen wir nicht«, sagte Tyson. »Immerhin haben wir keine Informationsquellen mehr. Abgesehen von unserem Freund Wen Shubai, dessen Ratschläge sich als wenig zuverlässig herausgestellt haben. Zudem hat das, was sich gestern zugetragen hat« – die Kollision der Dectaur mit dem Fischkutter – »die Dinge so weit verändert, dass ich nicht mehr weiß, ob irgendjemand jenseits des Flusses« – im Weißen Haus – »noch an Wens Meinung interessiert ist. Die Methode der Konfrontation hat bisher nicht funktioniert.«
»Was jetzt?«, fragte Wells.
Tyson trommelte auf den Tisch und schreckte damit die Katzen auf. Sie blinzelten verschlafen, suchten ein neues Plätzchen und legten sich wieder nieder. »Was wollen die Chinesen? Warum haben sie dieses Abkommen mit dem Iran unterzeichnet? Warum provozieren sie uns? All dies hat von Anfang an keinen Sinn ergeben. Das müssen wir herausfinden.«
Wells hatte Tysons Effekthascherei satt. »Und wie sollen wir vier Ihrer Meinung nach an diese Antworten herankommen? Als ich das letzte Mal unser gesammeltes Wissen über China überprüfte, ergab das eine große fette Null.«
»Ich muss Ihnen j etzt reinen Wein einschenken. Ich glaube, oder besser gesagt, ich hoffe, dass wir doch noch eine aktive Informationsquelle in der Volksrepublik haben.«
In der Stille, die nun folgte, sah Wells zu Exley und Shafer hinüber. Beide wirkten ebenso überrascht wie er.
»Ein paar Jahre nach den Protesten auf dem Tiananmen-Platz nahm ein Oberst der Volksarmee Kontakt zu uns auf.
Er war evangelischer Christ, ein heimlich Konvertierter. Derartige Personen zählen zu unseren besten Quellen. Während der Neunzigerjahre lieferte er uns gutes Material. Aber als Robinson an die Chinesen herantrat, versiegte die Quelle und blieb vollständig trocken. Damals verstanden wir nicht warum. Heute scheint es offensichtlich zu sein. Er zog den Kopf ein, damit ihn Robinson nicht ans Messer lieferte.«
»Haben Sie eine Ahnung, warum er uns nicht einfach von Robinson erzählte?«
»Vielleicht wusste er nicht genug, um Robinsons Identität preiszugeben. Vielleicht aber auch das Gegenteil. Vielleicht wussten so wenige Personen über Robinson Bescheid, dass unser Mann fürchtete, sich selbst
Weitere Kostenlose Bücher