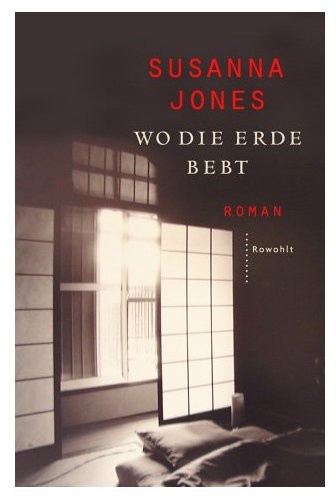![Jones, Susanna]()
Jones, Susanna
ich mich verabschieden sollen. Sie wusste, wie sie von da nach Hause kam. Aber mir fiel etwas ein, und ich machte blöderweise den Mund auf und teilte es Lily mit. Ich dumme Kuh.
«Morgen gehe ich mit Natsuko wandern - das ist eine Kollegin von mir -, und ich glaube, sie würde Ihnen gefallen. Es ist keine besonders schwierige Wanderung, müsste aber ganz interessant werden. Vielleicht hätten Sie Lust mitzukommen.»
Lily fühlte sich hilflos, einsam, sie hatte den Boden unter den Füßen verloren, sehnte sich nach Zuwendung. Ich kannte das. Lassen Sie mich erklären, warum ich mich so sehr dagegen sträubte, ihr meine Zeit zu opfern. Das lag an einer anderen Geschichte, einer Geschichte, die ich Lily nicht erzählt hatte. Und die ich der Polizei nicht erzählen werde. Ich habe sie nur Teiji erzählt. Ich habe sie Teiji einmal erzählt, und wenn man die Geschichte seines Lebens einmal erzählt hat, dann reicht's.
Und das kam so. Ich lag in Teijis Bett. Er schlüpfte neben mir unter die Decke, wärmte mir die Haut mit seiner Haut, hielt die Kamera mit ausgestrecktem Arm hoch, richtete sie aus und machte ein Foto von uns beiden. Das war eines seiner wenigen Bilder, auf denen er selbst zu sehen war. Er legte die Kamera beiseite und flüsterte etwas. Was flüsterte er? Im Nachhinein erscheint es mir so, als hätten Teiji und ich niemals Worte verwendet, aber das kann natürlich nicht sein. Ich erinnere mich an Situationen, in denen wir mit Sicherheit gesprochen haben, aber ich weiß keine einzige Silbe mehr von dem, was wir sagten. Es kommt mir so vor, als hätten wir Gefühle und Gedanken wie auf telepathischem Weg ausgetauscht, aber das ist eine zu phantastische Vorstellung. Ich kann Teijis Stimme nicht hören, aber er muss eine Stimme gehabt haben. Wenn ich mich konzentriere, dann höre ich nur ein Geräusch wie das Trommeln von Regentropfen, das aus unseren Mündern kommt. Keine Pausen, kein Abwechseln, nur fallendes Wasser. Ich kann nicht beschwören, was seine genauen Worte waren, aber ich glaube, er sagte an dem Abend Folgendes:
«Wie bist du hergekommen?»
Ich widerstand der Versuchung zu sagen: «Erst mit der Yamanote-Linie und anschließend zu Fuß», denn ich wusste, dass das nicht die Antwort auf seine Frage war.
«Ich weiß es nicht», sagte ich.
«Aber du bist hier, in Japan. Ich habe dich gefunden. Du bist aus einem anderen Land, einem anderen Kontinent nach Japan gekommen, von so weit weg, und ich hab dich in meiner Kamera gefunden. Wie?»
Und ich erzählte es ihm. Ich fing ganz von vorn an und erzählte ihm beinah alles.
3
Ich fing mit meiner Geburt an.
Lucy Fly wurde 1965 in Scarborough geboren, in einem viktorianischen Reihenhaus mit strenger grauer Backsteinfront und drei massiven Stufen vor der Haustür. Der Nordseewind blies so heftig gegen die Tür, dass man Hut und Mantel anziehen musste, um auch nur die Milchflaschen rauszustellen. Lucy war das jüngste der acht Kinder, die George und Miriam Fly ihr Eigen nannten, und das einzige Mädchen. Sie kam zu Hause zur Welt, im Dunkeln. Die Schlafzimmerglühbirne ging genau in dem Augenblick mit einem Knall aus, als die Hebamme Miriam anfeuerte, ein letztes Mal zu pressen. George war unten und sah sich ein Rugby-Spiel an, aber er war so freundlich, sich lange genug davon loszureißen, um die durchgebrannte Birne durch die vom Außenklo zu ersetzen. Als sie endlich was sehen konnte, starrte Miriam, die äußerst stolze Mutter von sieben Söhnen, unglücklich auf die rote Schweinerei, die aus der schmerzenden Spalte zwischen ihren Beinen hochgehoben wurde. Sie hatte auf ihren achten Sohn gewartet. Er hätte den Namen Jonah bekommen.
«Äußerst passend», hatte George die Woche davor in sich hineingemurmelt, «wo er doch dem Bauch eines Wals entsteigen wird.»
Aber Miriam konnte lediglich einen Jungen ohne Schniedel sehen.
«Es ist ein niedliches Mädchen!», sagte die Hebamme, während sie das Baby sauber wischte.
Miriam sah nichts von Niedlichkeit. Es war ein spilleriges pinkfarbenes Mädchen ohne Hals und mit kohlschwarzen kullerigen Krähenaugen. Es war ihr nie in den Sinn gekommen, dass sie ein Mädchen hervorbringen könnte. Sie war eine leistungsfähige Männer-Produktionsstätte und betrachtete es als ihr Recht, eine solche zu sein. Miriam war kein böser Mensch, aber ihre Kindheit war von einem völligen Mangel an männlichen Wesen vergällt gewesen. Ihr Vater war im Krieg gefallen. Sie hatte zwei Schwestern, keine Brüder, und
Weitere Kostenlose Bücher