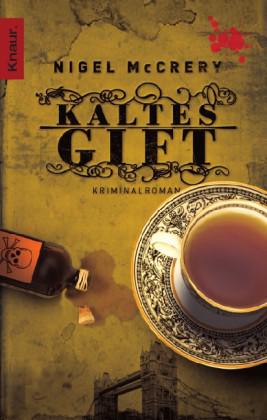![Kaltes Gift]()
Kaltes Gift
Durcheinander. Gepflasterte Wege wanden sich zwischen den
Reihen hindurch, und Steintreppen mit Handläufen aus Stahlrohr
verbanden sie mit dem Strand. Das alles sah jetzt ziemlich langweilig
und traurig aus, aber im Hochsommer würde es hier bestimmt überall von
Kindern und Eltern nur so wimmeln und durchdringend nach Sonnenöl
riechen.
Behutsam stieg Daisy die nächstgelegene Treppe zum Strand
hinunter. Strandgras wuchs an den Rändern der Stufen und aus jeder
Ritze: abgehärtete Überlebenskünstler, die noch unter den härtesten
Bedingungen fortbestehen würden. Flugsand hatte sich in jeden Spalt und
jeden Riss gesetzt. Bei einer oder zwei Hütten waren die Türen
eingeschlagen worden, wahrscheinlich von Teenagern, die einen
Unterschlupf gesucht hatten, um ihre Zigaretten zu rauchen und ihre
unwilligen Mädchen zu betatschen. Als sie die unterste Stufe der Treppe
erreichte und vorsichtig auf den nassen Sand darunter trat, spürte sie
die Hütten in ihrem Rücken wie eine Last, wie hundert starrende Augen.
Die Flut war im Ablaufen begriffen, und jeder ihrer Schritte
quetschte Wasser aus dem Sand, während sie dahinging. Das ablaufende
Wasser hatte ein winziges Riffelmuster im Sand hinterlassen, und alle
paar Meter lagen zusammengeringelte kleine Sandröhren. Zurückgelassener
Auswurf der Köderwürmer auf ihrer Suche nach Fressbarem. Irgendwo unter
diesen Sandhäufchen und unter den von der Flut am Strand
zurückgelassenen Wasserlachen gab es eine ganze Welt blinden,
unbewussten Lebens, das sich wand und wimmelte – etwas, an das
diese Leute niemals dachten, wenn sie am Strand in der Sonne lagen, um
möglichst braun zu werden, wenn sie darauf herumrannten und Volleyball
spielten oder sich in die Wogen stürzten. Sie wussten nichts von dem
Grauen, das so dicht unter der Oberfläche lauert.
Zu ihrer Rechten ragte der massige Umriss der Landungsbrücke
vor dem Himmel auf und versperrte ihr den Ausblick auf die Seite von
Leyston, die sie im Laufe der vergangenen Wochen schon so gut
kennengelernt hatte. Einer Laune folgend, schickte sich Daisy an,
zwischen den gewaltigen Holzpfählen hindurchzugehen, die die Brücke
trugen. Sie würde darunter hindurchgehen und sich an der anderen Seite
einen Weg hinauf zur Strandpromenade suchen. Von dort konnte sie dann
einen Bus nehmen und zu ihrer Wohnung zurückfahren.
Die massigen Holzpfähle standen jeweils in einer Vertiefung,
ausgewaschen von den zurückflutenden Wellen, die um sie herumwirbelten.
Das Holz selbst war bis zu einer Höhe von gut zwei Metern mit Algen
bewachsen, mit Blasentang und vielem anderen. Moosbewachsene
Felsbrocken lagen auf dem von Wasser vollgesogenen Sand verstreut, und
Daisys Nase litt unter dem überwältigenden Gestank nach verwesender
Vegetation. Sie ging weiter, mied stehende Wasserlachen und vor sich
hinrottende Holzstümpfe, die aus dem schlammweichen Sand ragten, und
hielt die Luft an, bis sie die andere Seite erreicht hatte.
Dort beruhigten das Panorama des Himmels und der
Strandpromenade sie ein wenig, und sie wagte es sogar, ein wenig in
Richtung Wasser zu gehen, der ablaufenden Flut nach. Eine kleine Stimme
in ihrem Kopf flüsterte ihr zu, sie solle doch die Schuhe ausziehen und
eine Weile durchs Wasser waten, doch sie wusste, das hätte lächerlich
ausgesehen. Also trabte sie weiter am Strand entlang, vor sich das
massive Vorgebirge der Naze. Es waren auch noch andere Leute am Strand,
allein oder paarweise, führten Hunde spazieren oder wanderten einfach
vor sich hin. Sie fühlte sich isoliert, verletzlich, aber auch
irgendwie anonym. Für jeden auf der Strandpromenade war sie nur eine
weitere Gestalt, die über den Sand lief.
Daisy wägte ihre Optionen ab. Das Theater, befand sie zögernd,
war kein gutes Jagdrevier, wenn auch bloß wegen der Tatsache, dass
Sylvia und Kenneth womöglich begeisterte Theatergänger waren, und Daisy
wollte keine gutgemeinte Störung bei ihrer Pirsch. Vielleicht lohnte es
sich, einmal den Witwen-Freundschaftskreis zu erkunden. Außerdem konnte
sie ja gelegentlich auch an einem Sonntagabend in einer der Kirchen
auftauchen. Morgenandachten, fand sie, zogen eine zu große
Menschenmenge an. Schlimmer noch, dort kannte man sich untereinander,
verkehrte miteinander. Gottesdienste am Sonntagabend dagegen waren mehr
etwas für Alleinstehende, für Menschen, die lieber allein beteten als
in Gesellschaft. Dort sollte es ihr eigentlich gelingen, ein passendes
Opfer zu finden. Das Problem war nur, dass die Sorte
Weitere Kostenlose Bücher