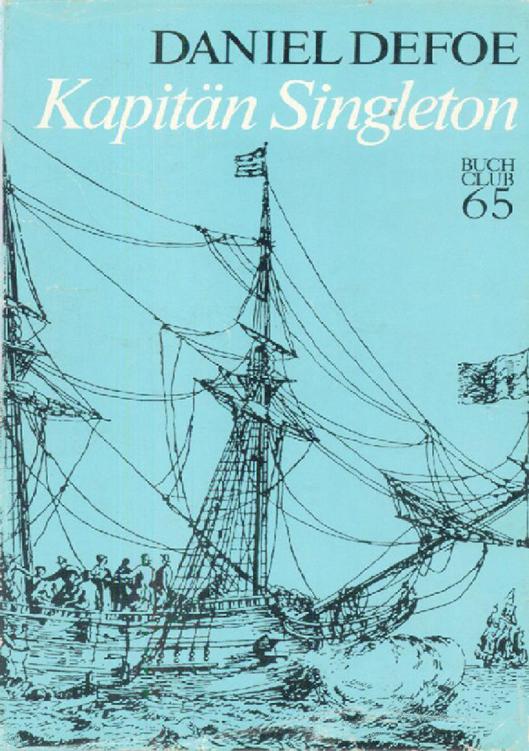![Kapitän Singleton]()
Kapitän Singleton
hatte, sehr anständige Menschen.
Sie bereiteten unseren Leuten keinerlei Schwierigkeiten, denn die Aussicht auf Gewinn veranlaßte sie, nicht neugierig zu sein, und an der Schaluppe entdeckten sie nicht das geringste. Was die Tatsache betraf, daß sie ihnen Gewürze verkauften, die von so weit her stammten, so war das anscheinend dort nichts Neues, wie wir glaubten, denn bei den Portugiesen gab es oftmals Schiffe, die aus Macao in China kamen und Gewürze brachten, die sie den chinesischen Händlern abgekauft hatten; und diese wiederum trieben häufig Handel auf den holländischen Gewürzinseln und tauschten die aus China mitgebrachten Waren gegen Gewürze ein.
Dies kann man tatsächlich als die einzige Handelsfahrt bezeichnen, die wir unternahmen. Jetzt waren wir wirklich sehr reich, und ganz natürlicherweise standen wir nun vor der Überlegung, wohin wir uns als nächstes wenden sollten. Unser Löschungshafen, wie wir ihn hätten nennen können, lag auf Madagaskar in der Bucht von Mangahelly; aber eines Tages nahm mich William in seiner Kajüte auf der Schaluppe beiseite und erklärte mir, er wolle etwas ernsthaft mit mir besprechen. So schlossen wir uns ein, und William begann:
„Willst du mir erlauben, offen mit dir über deine gegenwärt ige Lage und über die künftigen Aussichten in deinem Leben zu reden?“ fragte er. „Und versprichst du mir bei deiner Ehre, daß du mir nichts übelnehmen wirst?“
„Herzlich gern“, erwiderte ich. „William, ich habe Euren Rat immer für gut befunden, und Eure Pläne sind nicht nur gründlich durchdacht gewesen, sondern Eure Empfehlungen haben uns auch immer Glück gebracht, und deshalb könnt Ihr sagen, was Ihr wollt, ich verspreche Euch, daß ich es Euch nicht übelnehmen werde.“
„Aber das ist noch nicht alles, was ich fordere“, sagte Will iam. „Versprich mir, das, was ich dir sagen werde, unter der Mannschaft nicht bekannt zu machen, wenn dir mein Vorschlag nicht gefällt.“
„Das werde ich nicht, William“, antwortete ich, „ich gebe Euch mein Wort darauf.“ Und ich beschwor auch das bereitwillig.
„Nun habe ich nur noch einen Punkt mit dir abzusprechen“, sagte William, „nämlich daß du, wenn du meinen Vorschlag betreffs dich selbst nicht billigst, daß du dann mir und meinem neuen Arztkollegen erlaubst, ihn unsererseits auszuführen, soweit er dir nicht zum Schaden und zum Verlust gereicht.“
„Mit allem will ich einverstanden sein, William“, sagte ich, „außer damit, daß du mich verläßt. Von dir aber kann ich mich unter keinen Umständen trennen.“
„Nun“, sagte William, „ich habe auch gar nicht die Absicht, mich von dir zu trennen, es sei denn, du selbst veranlaßt es. Aber gib mir in allen drei Punkten Sicherheit, und dann sage ich dir offen, was ich denke.“
So versprach ich ihm denn alles, was er wollte, so feierlich wie nur möglich und dabei so ernsthaft und ehrlich, daß William nicht zögerte, mir seine Gedanken zu offenbaren.
„Nun, dann erstens“, erklärte William, „will ich dich fragen, ob du nicht der Meinung bist, daß wir, du und alle deine Leute, nun reich genug sind und tatsächlich ein so großes Vermögen zusammenbekommen haben (auf welche Weise auch immer, das steht hier nicht zur Debatte), daß wir kaum wissen, was wir damit anfangen sollen?“
„Freilich, das stimmt, William“, sagte ich, „du hast so zie mlich recht; ich glaube, wir haben großes Glück gehabt.“
„Nun, dann möchte ich fragen“, fuhr William fort, „ob du dir, da du also genug erworben hast, irgendwelche Gedanken darüber gemacht hast, dieses Gewerbe aufzugeben, denn die meisten Leute ziehen sich aus ihrem Geschäft zurück, wenn sie mit ihrem Erwerb zufrieden und reich genug sind, da niemand Handel treibt nur um des Handels willen, und noch viel weniger rauben die Menschen nur um des Diebstahls willen.“
„Aha, William“, sagte ich, „jetzt verstehe ich, worauf Ihr hinauswollt. Ich wette mit Euch, Ihr sehnt Euch nach Hause“, setzte ich hinzu.
„Ja, freilich“, sagte William, „du sagst es, und hoffentlich geht es auch dir so. Für die meisten Menschen, die sich in der Fremde befinden, ist es natürlich, daß sie schließlich wieder heimkehren möchten, besonders dann, wenn sie reich geworden sind und wenn sie (du gibst ja zu, daß das bei dir der Fall ist) reich genug sind – so reich, daß sie nicht wissen, was sie mit mehr Geld anfangen sollten, wenn sie es hätten.“
„Siehst du, William“,
Weitere Kostenlose Bücher