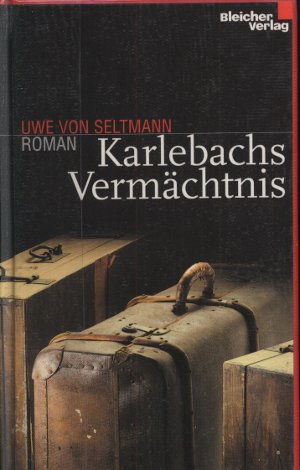![Karlebachs Vermaechtnis]()
Karlebachs Vermaechtnis
zu machen.« Er fragte mich, ob ich dabei gewesen sei. Ich nickte, unfähig etwas zu sagen.
»Komm«, sagte Doktor Wesenberger und legte seine Hand auf meine Schulter. »Du bist ja völlig durchnässt.« Ich schüttelte den Kopf und blieb sitzen. Doktor Wesenberger stopfte seine Pfeife, schickte Röther zum Bestatter und ließ sich neben mir nieder. Wir schwiegen. Der Tabakrauch vermischte sich mit dem Nebel und stieg langsam empor. Ich blickte ihm nach und sah, wie der schwarze Vogel im Wipfel der kahlen Eiche seine Flügel ausbreitete und davonflog. Immer höher und höher, bis er nicht mehr zu erkennen war.
Ich drückte Doktor Wesenberger die Hand, erhob mich und ging. Es hatte aufgehört zu nieseln.
2
Drei Tage später wurde Opa Bernhard beerdigt. Es war ein strahlender, klarer Herbsttag. Zum ersten Mal seit Wochen schien wieder die Sonne. Ich hatte die Zeit nach Opa Bernhards Tod in einer Depression verbracht und mich in meinem Zimmer verkrochen. Ich wollte niemanden sehen, mit keinem reden, nichts essen. An jenem Mittwoch wachte ich auf und hatte Hunger. Ich setzte mich an den Frühstückstisch und ließ es mir schmecken. Dann spazierte ich mit meinem Hund, einem altersschwachen Dalmatiner namens Axel, ins Italienische Eck. Ungefähr auf halber Strecke langte ich in meine Jackentasche und fand Opa Bernhards Zettel. Ich las ihn noch einmal, diesmal bis zum Ende:
»Lieber Ulrich, ich weiß, dass meine letzte Stunde gekommen ist. Wenn der Herr mich holt, will ich dort sein, wo er mir immer am nächsten war.« So weit war ich bereits am Sonntag gekommen. »Ich wollte dir noch vom Judenhaus erzählen«, las ich jetzt weiter, »aber es ist zu spät. Dort ist etwas Schreckliches passiert. Ich weiß davon, aber war zu feige …« Opa Bernhards Schrift wurde zittriger. Ich konnte sie kaum noch entziffern. Außerdem schien sein Kugelschreiber nicht mehr funktioniert zu haben. Ich hielt den Zettel gegen die Sonne.
»Zwei Männer unseres Dorfes …«, konnte ich entziffern, dann: »Unrecht Gut darf nicht gedeihen«, und zum Schluss: »Bitte damit ich in Frieden sterben kann.«
Ich setzte mich auf einen von der Sonne erwärmten Stein und kraulte Axels Hals. Wieder und wieder las ich den Zettel. Vergebens. Die Namen der beiden Männer blieben unsichtbar.
An das Judenhaus, das Opa Bernhard erwähnt hatte, erinnerte ich mich noch gut. Es hatte in der Mitte des Dorfes gestanden, gegenüber der Kirche, gleich hinter dem Gasthof Sonne. Wenn ich auf dem Weg zum Kindergarten dort vorbei musste, überkam mich jedes Mal ein Schauern. Die Fensterläden waren fast alle geschlossen. Nur in einem Zimmer lebte noch eine alte Frau. Ich hielt sie für eine Hexe. Sie hatte eine riesige krumme Nase, graue wirre Haare und einen stechenden Blick. An ihrem Kinn klebte eine fette Warze. Ich stellte mir vor, dass sie in dem Haus eine wunderhübsche Prinzessin versteckte, die ich befreien wollte, wenn ich einmal groß und stark wäre. Dazu kam es nicht mehr, denn das Judenhaus wurde abgerissen, als ich etwa sieben Jahre alt war und die erste Klasse besuchte. Das Judenhaus sei ein Schandfleck gewesen, hatte unser Lehrer damals gesagt. Viele Dorfbewohner ließen es sich nicht nehmen, dem Schauspiel beizuwohnen, das die dörfliche Eintönigkeit durchbrach. Sie klatschten Beifall, als die Abrissbirne die starken Mauern fällte. Mir imponierte der Baggerfahrer, der wie ein Held durch die Menge schritt und mit seiner kräftigen Hand den Kindern über die Haare strich. Danach hatte ich einen neuen Berufswunsch: Baggerfahrer! Wer so begeistert gefeiert wurde, musste etwas Besonderes geleistet haben. Aber warum das Judenhaus ein Schandfleck war, erklärte uns der Lehrer nicht. Tief in Gedanken versunken erreichte ich die Lichtung, die von einem schräg einfallenden Sonnenstrahl gestreift wurde. Nebel dampfte über der feuchten Wiese. Für einen Novembertag war es erstaunlich mild.
Auf der Bank, eingehüllt in einen grünen Lodenmantel, saß Onkel Alfred, der ungefähr so alt war wie Opa Bernhard. Tag für Tag, bei Wind und Wetter, wanderte er mit seinem Terrier Struppi und einem Feldstecher, der noch aus Wehrmachtsbeständen stammte, durch die Flur und beobachtete Tiere und Pflanzen. Er hatte mich längst gehört, reichte mir die Hand und bedeutete mir zu schweigen. Ich setzte mich neben ihn und schaute in die Richtung, in die er mit dem Feldstecher starrte, konnte aber nichts erkennen.
»Na, Ulrich, musste immer noch so viel lesen?«,
Weitere Kostenlose Bücher