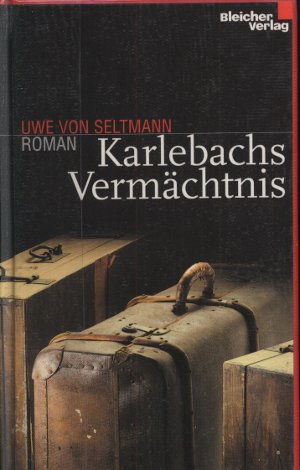![Karlebachs Vermaechtnis]()
Karlebachs Vermaechtnis
Erhaltung des Kriegerdenkmals. Einige trugen Uniformen, andere hatten ihre Vereinsfahnen bei sich. Hinter den wenigen Angehörigen, die in den ersten beiden Reihen Platz nahmen und von denen ich außer der Familie von Opa Bernhards Sohn kaum jemanden kannte, saßen die Honoratioren des Dorfes: Fabrikant Frick, der Chefredakteur der Lokalpost Stumpf, Doktor Wesenberger, der Ortsvorsteher, der Schulrektor, der Wirt der Dorfkneipe (die Opa Bernhard, da er Abstinenzler war, kaum einmal von Innen gesehen hatte), dann der vollzählig versammelte Kirchenvorstand, dem Opa Bernhard über 30 Jahre angehört hatte, zwei frühere Dorfpfarrer waren angereist, ehemalige Arbeitskollegen, ja sogar zwei Schulkameraden. Ich entdeckte Onkel Alfred, dessen schwarzer Anzug aussah, als ob er ihn schon bei seiner Konfirmation getragen hätte, und links neben dem Eingang an der Wand lehnend Flurschütz Röther.
Die Trauerfeier wurde von Frau Pfarrerin Nolte-Merkel und von Oberkirchenrat Hans-Dieter Knecht geleitet, der es sich nicht nehmen ließ, die Predigt selber zu halten. Im schwarzen Talar und von der Seite betrachtet ähnelte er noch mehr als sonst einem Gartenzwerg. Seine Pausbäckchen waren gerötet, ebenso seine Stirn. Der weiße Bart, den er sich um den Mund ausrasiert hatte, sodass Lippen und Kinn frei blieben, kam in dem schummrigen Licht besonders zur Geltung. Knecht würdigte Opa Bernhard als einen tiefgläubigen und fröhlichen Menschen, der immer für andere da gewesen sei und besonders viel Herz für Menschen am Rande der Gesellschaft gezeigt habe.
Ausnahmsweise mal nicht gelogen, dachte ich und sehnte das Ende seiner Predigt herbei, denn die Luft in der überfüllten Kapelle war zum Schneiden dick. Nach dem letzten gemeinsamen Lied wurde der Sarg von Mitgliedern des Kirchenvorstands zum Grab getragen. Wir vom Posaunenchor marschierten vorneweg, an der Spitze Pietsch, der unaufhörlich nach links und rechts grüßte. Draußen harrten hunderte Trauergäste aus, die in der Kapelle keinen Platz mehr gefunden hatten. Wir sollten, wenn sich alle um das Grab versammelt hatten und der Sarg hinuntergelassen wurde, Opa Bernhards Lieblingslied spielen, einen alten Choral mit einer getragenen, leicht melancholischen Melodie.
Die erste Strophe gelang uns noch recht ordentlich, doch dann, beim feierlichen Refrain, mussten die Ersten aussetzen. Pietsch, der als Abgeordneter den Ruf hatte, besonders hart gesotten und ausgebufft zu sein, funkelte uns strafend an. Bei der zweiten Strophe brachte auch ich keinen Ton mehr heraus, bei der dritten spielte nur noch das Ehepaar Schröder, das noch nicht lange im Dorf wohnte und Opa Bernhard kaum gekannt hatte. Pietsch fixierte uns mit verächtlicher Miene und dirigierte unermüdlich weiter, obwohl das Schluchzen der Trauergäste längst die kümmerlichen Reste des Posaunenchors übertönte.
Sogar der Totengräber Oleander, ein kleines, dürres Männlein mit roter Nase und abstehenden Ohren, das vor kurzem für seinen vierzigjährigen treuen Dienst geehrt wurde und schon mehr als tausend Gräber geschaufelt haben soll, zeigte Rührung.
»Da hilft nur ein Schnaps«, schniefte er, während ich mein Tenorhorn einpackte. Er zog einen Flachmann aus dem Schaft seines Gummistiefels, nahm einen Schluck und reichte mir die Flasche.
»Danke«, sagte ich, »mir ist schon schlecht.« Er trank noch einmal.
»Wenn du so weiter schluckst, schaufelst du dir bald dein eigenes Grab«, mahnte ich.
»Guter Witz«, lachte der Totengräber, zog sich einen blauen Kittel über den schwarzen Dienstanzug, schulterte seine Schaufel und schlurfte davon.
Bei der Nachfeier im Dorfgemeinschaftshaus, dem größten Saal des Ortes, legte sich die Trauerstimmung weitgehend. Mir war in der Kapelle, unter Opa Bernhards Verwandten, eine junge Frau mit langen dunklen Haaren und tiefbraunen, kugelrunden Augen aufgefallen. Mehrmals hatten sich während der Beerdigung unsere Blicke gekreuzt. Ich setzte mich mit meinem Bruder, der in Berlin als Musiker arbeitete, ihr gegenüber und fragte in die Runde, wer denn wie mit Opa Bernhard verwandt oder bekannt sei. Ein älteres Ehepaar, das in ein Gespräch vertieft war, antwortete gar nicht, eine etwa siebzigjährige Dame sagte, sie sei eine Cousine von Opa Bernhards verstorbener Frau. Als die Frauenhilfe Kaffee, Bienenstich und Streuselkuchen auftrug, wurde unsere kurze Unterhaltung unterbrochen. »Und Sie?«, fragte ich die Dunkelhaarige, nachdem ich den ersten Bissen des trockenen
Weitere Kostenlose Bücher