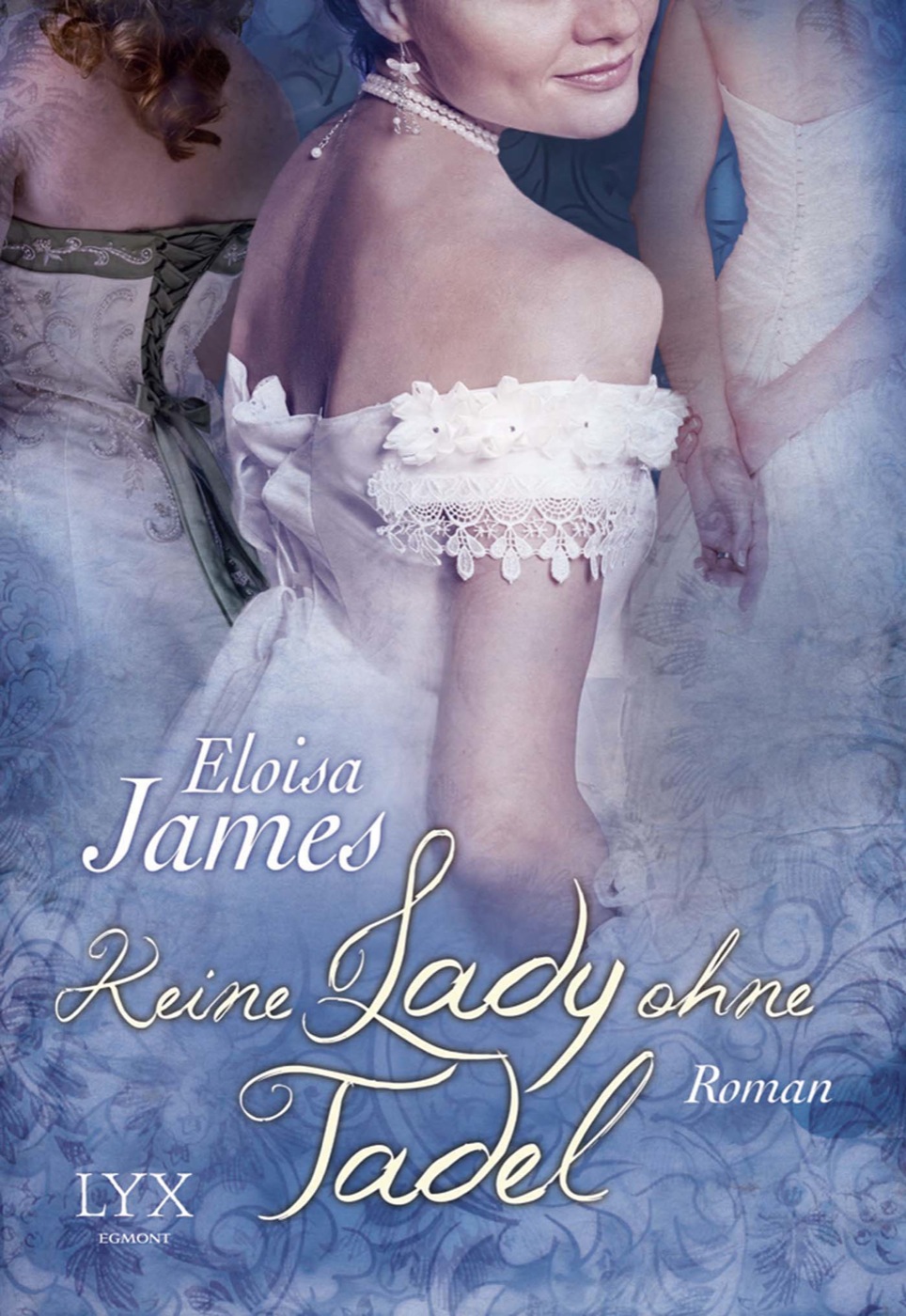![Keine Lady ohne Tadel]()
Keine Lady ohne Tadel
könnte mehr Männer aus meinem Bekanntenkreis dazu bringen, eine Schuld einzugestehen.«
»Aber ich will keinen Mann heiraten, nur damit er sein Gewissen beschwichtigen kann. Und als ich den Marquis vorhin gesehen habe, bin ich von Panik ergriffen worden.«
Stephen begann die Situation allmählich Spaß zu machen. Zwar hatte er nie um die Liebe einer Frau gebettelt, doch ebenso wenig hatten die Frauen bei ihm Schlange gestanden. »Ich bin also eine ganz nützliche Lösung für Ihr Problem?«, erkundigte er sich.
»Es tut mir wirklich leid, Sie auf diese Weise zu benutzen. Aber wäre es Ihnen sehr unangenehm, weiterhin meinen Verlobten zu spielen? Nur so lange, bis der Marquis abreist. Wir können dafür sorgen, dass niemand außerhalb unseres kleinen Zirkels von unserer Verlobung erfährt. Und Bonningtons Mutter könnte ihren Sohn schon morgen früh davon überzeugt haben, dass er besser daran täte abzureisen. Wenn er glaubt, dass ich einen ehrenwerten Mann wie Sie heirate, muss er sich doch nicht mehr schuldig fühlen!«
»Ich beuge mich Ihrer besseren Kenntnis von Marquis Bonningtons Gemüt. Ich meinerseits hätte ihn nicht als einen Mann eingeschätzt, der so leicht aufgibt. Auf mich macht er eher den Eindruck eines Terriers mit einem Knochen.«
»Ich will aber nicht dieser Knochen sein«, sagte Esme verzweifelt. »Ich weiß, ich sehe zurzeit nicht gerade vorteilhaft aus und bin unter den gegebenen Umständen gewiss keine begehrenswerte Verlobte, doch wenn Sie dem Marquis einen treu ergebenen, zukünftigen Gatten vorspielen könnten, dann wäre ich Ihnen ewig dankbar.«
Stephens Lachen hallte im Zimmer wider. Er erhob sich und küsste ihre Hand, dann half er ihr auf. »Da Sie meine Gattin sein werden, darf ich mir wohl die Freiheit erlauben, Sie darauf hinzuweisen, dass Sie erschöpft wirken. Darf ich Sie nach oben begleiten?«
»Oh, vielen Dank!«, rief Esme und nahm seinen Arm. Auf dem Weg begegneten sie niemandem, und Stephen sah seine angebliche Verlobte mit ungeheurer Erleichterung in ihrem Zimmer verschwinden.
Nach dieser Aufregung musste er sich kurz an die Wand des Korridors lehnen. Er schloss die Augen und fragte sich, ob er nicht zufällig träumte. Denn es schien unmöglich, dass ausgerechnet er – ein geachteter, langweiliger Abgeordneter – einerseits eine leidenschaftliche Affäre mit einer Frau unterhielt, um deren Ehemann eifersüchtig zu machen, und andererseits leidenschaftlich in eine andere verliebt sein sollte, damit sie vor ihrem Liebhaber Theater spielen konnte.
Er vernahm das leise Rascheln von Seide. Bea, natürlich. Sie schien überall zu sein, Bea mit ihren gemalten Augenbrauen und dem roten Mund.
»Wollen Sie zu Bett gehen?«, fragte er und gab seiner Stimme absichtlich einen anzüglichen Ton.
»Gute Nacht, Mr Fairfax-Lacy.« Sie schien tatsächlich auf dem Weg zu ihrem Zimmer zu sein. Stephen streckte ein Bein vor, sodass sie um ihn herumgehen musste, wenn sie ihren Weg fortsetzen wollte.
»Sir?«, fragte sie. Nun klang ihre Stimme völlig verändert. Wo war der freche, anzügliche Ton geblieben? Wo die glühenden Blicke, die sie so ausgiebig an ihm erprobt hatte?
»Würden Sie mich bitte vorbeilassen?« Sie wurde wütend, das konnte er sehen.
Stephen war von Frauen umlagert, die ihn anflehten, so zu tun, als wäre er ihr Geliebter. Er hingegen sehnte sich nach einer Frau mit echtem Verlangen, das ihn meinte. Und dass Bea ihm seit über zwei Tagen aus dem Weg ging und ihn nicht mehr mit ihren sinnlichen Blicken umgarnte, störte Stephen mehr, als er zugeben mochte. »Ich würde gerne ein paar der Gedichte lesen, die Sie mitgebracht haben«, sagte er.
»Ich kann Ihnen das Buch leihen, wenn Sie möchten. Oder Sie können es sich selbst holen. Ich habe es in der Bibliothek liegen lassen, da es offenbar alle lesen wollen.« Es war zu dunkel, um den Ausdruck ihrer Augen erkennen zu können.
Er streckte den Arm aus und fasste sie unter dem Ellenbogen. Meine Güte, wie er vor Verlangen brannte! Schon der Anblick ihres nackten Armes brachte ihn schier um den Verstand.
Stirnrunzelnd schüttelte sie den Kopf. »Ich halte das für keine gute Idee, Mr Fairfax-Lacy.«
»Schenken Sie mir eine weitere Einführung in die Dichtkunst«, bat er schmeichelnd.
»Sie möchten, dass ich Sie in die Bibliothek begleite?«
Er nickte. So viel hatte er gar nicht zu hoffen gewagt.
»Warum?« Nun schaute sie ihn voll an, und der Ausdruck ihrer Augen war keineswegs verführerisch, ja, nicht
Weitere Kostenlose Bücher