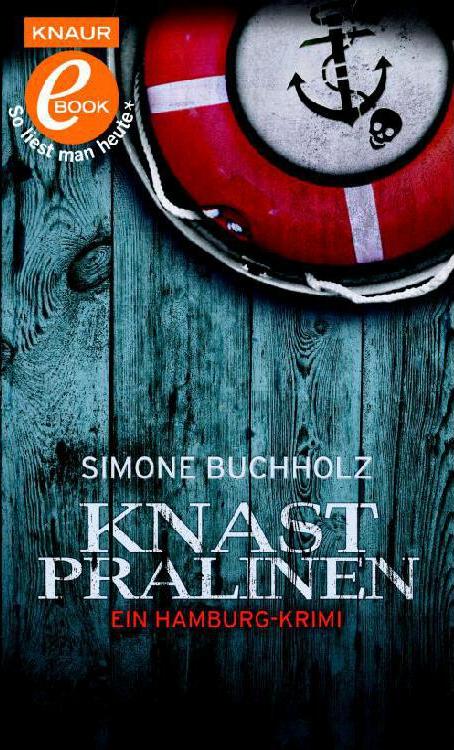![Knastpralinen: Ein Hamburg-Krimi (German Edition)]()
Knastpralinen: Ein Hamburg-Krimi (German Edition)
schmeiße meine Zigarette weg und laufe langsam weiter die Straße entlang. Ganz langsam, wegen Saigon. Plötzlich Geschrei. Eine Frauenstimme.
»Romy! Rooomy!«
Aus dem Kiezkindergarten schießt ein Mädchen raus, sie rast durchs offene Tor, dann über die Straße, ohne nach rechts und links zu schauen, dann zwischen zwei parkenden Autos durch, dann schlägt sie einen Haken nach links und läuft mir direkt in die Arme. Ich schnappe die Kleine und halte sie fest. Sie ist vielleicht vier Jahre alt, sie hat dunkelblonde lange Haare, die ungekämmt auf ihre Schultern fallen, sie trägt ein dunkelblaues T-Shirt und eine labberige Jeans. Ihre Beine sind lang und dünn, ihre Hüften wirken irgendwie knochig, die Jeans ist ihr beim Sprinten ein bisschen nach unten gerutscht. Sie sieht mich sehr ernsthaft an und schnauft.
»Mach das nie wieder«, sage ich.
»Lass mich in Ruhe«, sagt sie.
Ihr fehlt ein Schneidezahn.
»Mach das nie wieder«, sage ich noch mal. »Das ist gefährlich.«
Sie sieht mich böse an und presst die Lippen aufeinander.
»Romy.«
Eine junge Frau kommt über die Straße gelaufen. Sie wirkt resigniert.
»Ist doch immer das Gleiche«, sagt sie.
Sie streicht Romy über den Kopf, nimmt sie bei der Hand und bringt sie zurück in den Kindergarten. Romy legt keinen Einspruch ein. Mitten auf der Straße dreht sie sich noch mal um und kuckt mich an.
Ich frage mich, ob sie es gespürt hat. Ob Kinder das eigentlich mitkriegen, wenn sie Erwachsenen ähnlich sehen. Als Romy so bockig vor mir stand, hatte ich das Gefühl, eines der Bilder anzuschauen, die mein Vater von mir gemacht hat, als ich ein Kind war. Blick, Haare, Jeans – so sah ich auch immer aus. Trotzig, allein unterwegs, leck mich doch. Ich weiß nicht, ob ich auch schon so war, bevor meine Mutter meinen Dad und mich verlassen hat. Überhaupt weiß ich nicht viel aus der Zeit davor. Mein Vater wollte nie darüber reden, es brach ihm das Herz. Und ich erinnere mich nur an zwei Situationen mit meiner Mutter. Ich war ja noch so klein, als sie abgehauen ist. Ich erinnere mich daran, dass wir in einem kalten, gefliesten Treppenhaus standen. Das muss in Hanau gewesen sein, in dem Hochhaus, in dem wir damals gewohnt haben. Meine Mutter hatte mich auf dem Arm, zeigte in einer Tour auf die Deckenbeleuchtung und sagte immer wieder:
»Licht. Lampe.«
Das ist die schöne Erinnerung. Die andere geht so: Mein Vater sitzt auf der Couch und weint, tagelang. Ich verhalte mich still, sitze zu seinen Füßen und begreife Stück für Stück, dass sie nicht mehr da ist.
Manchmal frage ich mich, wie es meiner Mutter geht. Ich weiß, dass sie inzwischen zum dritten Mal verheiratet ist. Die Sache mit dem Kollegen von meinem Dad, mit dem sie damals in die USA abgehauen ist, hat nicht lange gehalten. Jetzt ist sie Zahnarztfrau und wohnt in Richmond, Wisconsin. Ich glaube nicht, dass sie glücklich ist. Aber geht mich ja nichts an. Es hat sie auch nicht interessiert, wie beschissen es meinem Vater all die Jahre ging. Und daran erinnere ich mich sehr gut.
Sie schreibt mir jedes Jahr zum Geburtstag eine Karte. Ich weiß gar nicht, wie sie das macht, so oft, wie ich umgezogen bin, bevor ich vor über zehn Jahren auf Sankt Pauli angespült wurde. Wahrscheinlich ist ihr Typ gar nicht Zahnklempner. Wahrscheinlich ist das ein CIA-Mann.
Ich breche mir ja keinen Zacken aus der Krone, wenn ich ihr auch mal schreibe.
Könnte ich schon machen.
Ich drehe mich um und gehe zurück zur Post in der Detlev-Bremer-Straße. An der Ecke kaufe ich in einem Souvenirshop eine Quatschpostkarte. Auf der Postkarte ist Paris zu sehen, der Triumphbogen. Und darunter steht: Millerntor.
Ich traue mich in den Laden des Harleyschusters, leihe mir einen Stift und schreibe die Adresse meiner Mutter auf die Karte. Weil sie die auf jeder Karte, die sie mir schickt, hinterlässt, kann ich sie auswendig. Als ich dem Harleyschuster seinen Stift zurückgebe, sieht er mich an, als würde er gleich bellen, aber da kann er ja nichts für.
Es ist zehn vor fünf, die Post hat noch auf. Ich gehe rein und stelle mich an. Vor mir in der Schlange stehen zwei Frauen. Die eine ist sehr jung, sie hat ein Victoria-Beckham-Betonfrisürchen auf dem Kopf, lila Satin-Sandaletten an den Füßen und ein Louis-Vuitton-Täschchen in der Hand. Die andere Frau ist so Anfang sechzig, sie ist groß und dick, und ihr aschblondes, glanzloses Haar hat schon lange Zeit kein Shampoo mehr gesehen. Trockenshampoo vielleicht. Die
Weitere Kostenlose Bücher