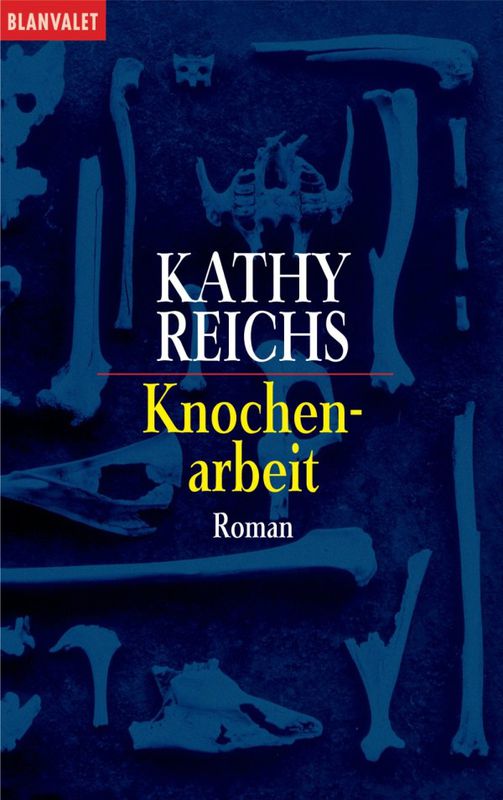![Knochenarbeit: 2. Fall mit Tempe Brennan]()
Knochenarbeit: 2. Fall mit Tempe Brennan
Kirche.
»Halleluja!« rief Schwester Pfadfinderin. Soviel zu kirchlicher Etikette.
In den nächsten zwei Stunden exhumierten wir Élisabeths Überreste. Die Nonnen und sogar Father Ménard stürzten sich in die Arbeit wie Anfangssemester bei ihrer ersten Ausgrabung. Schwesterntracht und die Soutane, raschelten und wehten, während Erde durchgesiebt, Tüten gefüllt, beschriftet und gestapelt und die einzelnen Arbeitsschritte auf Film festgehalten wurden. Auch Guy half, wenn auch noch immer etwas widerwillig. Es war die merkwürdigste Crew, die ich je gehabt hatte.
Den Sarg herauszuheben war nicht einfach. Obwohl er nur klein war, war das Holz stark beschädigt, so daß Erde ins Innere gerieselt war, was das Gewicht auf fast eine Tonne erhöhte. Der seitliche Graben war eine gute Idee gewesen, obwohl ich den Platz unterschätzt hatte, den wir brauchen würden. Wir mußten den Graben noch um etwa sechzig Zentimeter verbreitern, um Sperrholz unter den Sarg schieben zu können. Schließlich konnten wir das Ganze mit Hilfe eines Polypropylenseils herausheben.
Um halb sechs Uhr abends tranken wir Kaffee in der Küche des Konvents, erschöpft, mit langsam wieder auftauenden Fingern, Zehen und Gesichtern. Élisabeth Nicolet und ihr Sarg ruhten zusammen mit meiner Ausrüstung auf der Ladefläche des klostereigenen Transporters. Tags darauf würde Guy sie ins Laboratoire de Médecine Légale in Montreal bringen, wo ich als forensische Anthropologin für die Provinz Quebec arbeite. Da historische Tote nicht als forensische Fälle gelten, war vom Bureau du Coroner eine spezielle Genehmigung eingeholt worden, die Untersuchung dort durchzuführen.
Ich stellte meine Tasse auf den Tisch und verabschiedete mich. Die Schwestern dankten mir noch einmal und lächelten mit angespannten Gesichtern, denen die Nervosität wegen meiner bevorstehenden Befunde anzumerken war. Sie waren große Lächler.
Father Ménard brachte mich zum Auto. Es war dunkel geworden und schneite leicht. Die Flocken fühlten sich auf meinen Wangen merkwürdig warm an.
Der Priester fragte mich noch einmal, ob ich nicht lieber im Konvent übernachten wolle. Der Schnee funkelte im Lichtkegel der Portalbeleuchtung. Und ich lehnte wieder ab. Noch eine kurze Wegbeschreibung, und ich war unterwegs.
Nach zwanzig Minuten auf der zweispurigen Straße begann ich meine Entscheidung zu bedauern. Die Flocken, die anfangs träge im Licht meiner Scheinwerfer getanzt hatten, fielen jetzt in dichten, diagonalen Schwaden. Die Straße und die Bäume zu beiden Seiten waren bedeckt von einer weißen Membran, die immer undurchsichtiger wurde.
Ich packte das Lenkrad mit beiden Händen, und meine Handflächen waren feuchtkalt in den Handschuhen. Ich bremste ab auf fünfundsechzig Stundenkilometer. Fünfundfünfzig. Alle paar Minuten testete ich die Bremsen. Obwohl ich schon seit Jahren immer wieder in Quebec lebe, habe ich mich ans Autofahren im Winter nie gewöhnt. Ich halte mich zwar selber für hart im Nehmen, aber auf verschneiter Straße bin ich ein Hasenfuß. Ich zeige noch immer die typisch südliche Reaktion auf Winterstürme. Oh, Schnee – dann gehen wir natürlich nicht aus! Les Québecois schauen mich bloß an und lachen.
Angst hat etwas Erlösendes. Sie vertreibt die Erschöpfung. Müde wie ich war, blieb ich doch wachsam, hielt die Zähne zusammengebissen, den Hals gereckt, die Muskeln angespannt. Die Eastern Townships Autoroute war in einem etwas besseren Zustand als die Nebenstraßen, aber auch nicht sehr. Von Memphrémagog bis Montreal dauerte es normalerweise zwei Stunden. Ich brauchte fast vier.
Kurz nach zehn stand ich in meiner dunklen Wohnung und war froh, zu Hause zu sein. In meinem Quebecer Zuhause. Bienvenue. Mein Denken hatte bereits auf Französisch umgeschaltet.
Ich drehte die Heizung auf und schaute in den Kühlschrank. Trübe Aussichten. Ich wärmte mir ein tiefgefrorenes Burrito in der Mikrowelle auf und spülte es mit zimmerwarmer Kräuterlimonade hinunter. Keine haute cuisine, aber nahrhaft.
Das Gepäck, das ich am Dienstag abend hier abgestellt hatte, lag noch ungeöffnet im Schlafzimmer. Ich dachte nicht einmal ans Auspacken. Morgen. Mit dem festen Wunsch, mindestens neun Stunden zu schlafen, fiel ich ins Bett. Das Telefon weckte mich nach weniger als vier.
»Oui, ja«, murmelte ich.
»Temperance, Pierre LaManche hier. Es tut mir sehr leid, Sie um diese Zeit stören zu müssen.«
Ich wartete. In den sieben Jahren, seit ich für
Weitere Kostenlose Bücher