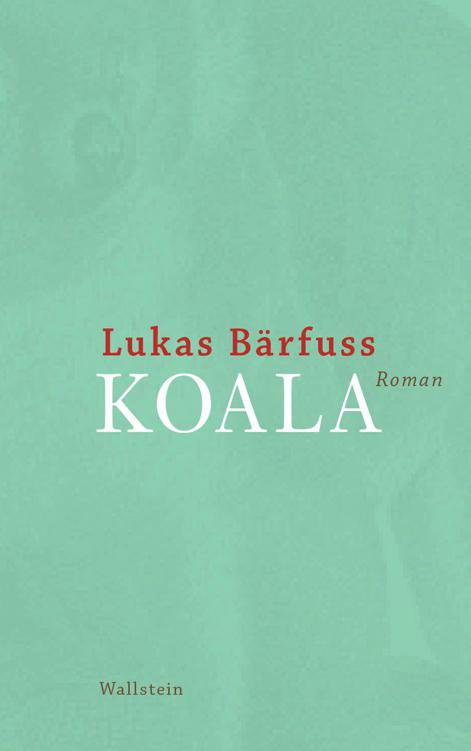![Koala: Roman (German Edition)]()
Koala: Roman (German Edition)
seiner Tat, drängte sich durch seinen Selbstmord in meinen Alltag, wie er es im Leben nie geschafft hatte.
Statt zu kämpfen, statt den Kampf anzunehmen, hatte er sich feige weggeschlichen. Er hatte niemals Verantwortung getragen, nicht im Beruf, nicht für eine Familie, es gab niemanden, der auf ihn angewiesen war. Man würde um ihn weinen, aber nicht lange. Er würde keine Spuren hinterlassen, weder im Guten noch im Schlechten. Man konnte sagen, dass es ihn überhaupt nicht gegeben hatte. Kein Werk, keine Nachkommen, ein paar Erinnerungen, Anekdoten, die noch eine Weile in der Familie kreisen würden. Sein einziges Erbe war Schmerz, eine Gewalttat, und es schien mir, als sei er ein Geist geworden, der meine Tage beherrschte und mich in den Nächten heimsuchte, als Erscheinung, als Schatten, als Kreatur, die an das Fenster klopfte und mich nicht schlafen ließ, mit pelzigen Ohren, stoisch, um nicht zu sagen lethargisch, und die mir etwas sagen wollte, ich wusste nicht, was, die keine Antwort gab, einfach da war. Sie konnte überall auftauchen, zu jeder Zeit. Manchmal verschwand sie mit dem Morgengrauen, manchmal saß sie am Küchentisch, schwamm in meinem Kaffee, zwei Knopfaugen darin. Die Kreatur blieb stumm, aber es schien, als würde sie mir Bilder schicken, Bilder, manchmal von großer Schönheit, eine fern im Osten liegende Bergkette etwa, die in der Abenddämmerung bläulich oszillierte. Einmal sah ich, wie Männer eine Schale an den Fuß eines Baumstammes stellten, eine Schale mit Gift, bevor sie sich lachend wegstahlen, ihren Häusern zu, die am Rande einer Lichtung standen. Bisweilen stiegen Bilder auf, die ich als Erinnerungen erkannte, so etwa, wie mein Bruder ausgestreckt auf seinem Sofa liegt, in quietschgelben Jogginghosen, wie er einen Joint baute, in jener Wohnung unter dem Dach, in der einzigen Zeit, als wir zusammenlebten. Ich sah das Klappmesser, mit dem er das Haschisch zerteilte, ich sah die Porzellanschale, in der er es aufbewahrte, die Federwaage, mit der er die Stücke wog, ich sah den Plastikbeutel mit den Geldscheinen aus dem Verkauf.
Es fiel mir auf, dass ich mir nicht erst jetzt Gewissensbisse machte, sondern mich immer schuldig gefühlt hatte. Ich durchforstete die Erinnerung nach einem Moment, da ich mich in seiner Gegenwart frei und unbefangen gefühlt hatte. Und ich fand keinen. Es war immer zu wenig. Was ich auch unternahm, welchen Aufwand ich betrieb, nie war es genug. Ich schämte mich für das eigene Glück. Was ich erreicht hatte, verwies nur auf meinen Ehrgeiz. Und mein Ehrgeiz war ein Beweis für das Begehren, und dieses Begehren versuchte ich vor ihm zu verstecken, weil ich ahnte, dass er sich seine Wünsche nie würde erfüllen können. Er lehnte die Arbeit ab, die Anstrengung, und verfolgte niemals ein Ziel. Er nahm, was ihm zufiel. Und da ihm wenig zufiel, hielt ich ihn für unglücklich. Er unterschied sich. Er investierte nicht. Er legte nichts zur Seite. Er besaß keinen Fleiß, er arbeitete nicht, er hing herum und ließ die Zeit verstreichen. Nicht dass er diesen Tod verdient hatte – aber er war die logische Folge seines Verhaltens.
Die Schuld war verteilt. Meine Gedanken kamen zur Ruhe. Aber bald zweifelte ich an der Härte meiner Schlussfolgerung, ich ging und öffnete die Büchse erneut.
Der Selbstmord sprach für sich, er brauchte keinen Erzähler. Die Gespräche, zu denen er einlud, vertrugen keine Stimme und keine Worte, sie fielen in das Innere der Trauernden, die gefangen waren in einer Rede ohne Anfang und ohne Ende. Sie wollte in einer kreisenden Bewegung in die Stille stürzen, gedieh an jenem versteckten Ort und wuchs mit jedem unausgesprochenen Wort, mit jedem Gedanken, der dieser Gewalttat eine weitere Frage stellte, ein schalltoter Raum, woher kein Echo drang. Nur Bilder stiegen hoch, die Bilder des toten Bruders in der Wanne, wie Marat nach dem Besuch der Charlotte Corday. Er war jetzt immer tot, in jeder Erinnerung. Das Lebendige war verschwunden, jeder Gedanke an ihn geronnen und erstarrt, als hätte er niemals gelebt, als sei jeder Moment in seinem Leben nur eine Vorbereitung, ein Schritt auf dem Weg in diese Badewanne gewesen. Und ich fragte mich, wann er den Weg eingeschlagen hatte, an dessen Ende die Badewanne stand. Waren dieses Lachen und jener glückliche Moment bereits vergiftet gewesen – etwa jener Nachmittag ein paar Wochen nach der Geburt unseres ersten Sohnes. Ich betrachtete die Fotografie, mein Bruder im Korbsessel mit dem Kind
Weitere Kostenlose Bücher