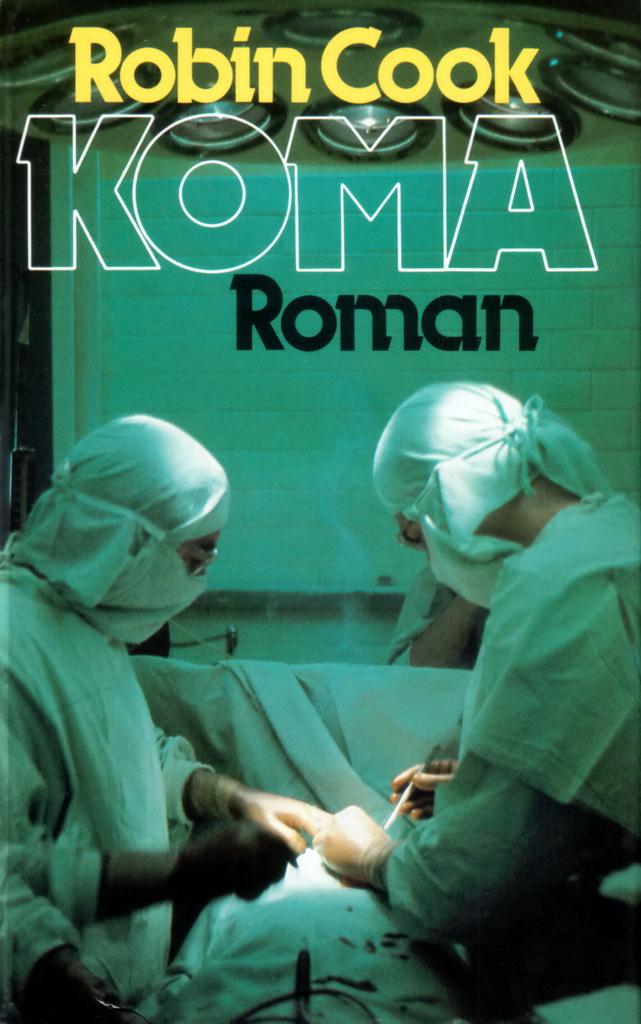![Koma]()
Koma
attraktiv – nicht verführerisch.« Die Nachbemerkung fiel Bellows gerade noch ein, und er drehte sich zu Susan um, weil er sehen wollte, welche Wirkung er mit dem Rückgriff auf ihre Unterhaltung im Café erzielt hatte.
Sie lächelte. Nach Bellows’ Erläuterungen hatte sie ihre ursprüngliche Abwehrhaltung aufgegeben.
»Und darum habe ich mich auch so blöd benommen, als Sie in den Umkleideraum marschiert kamen und mich in Unterhosen erwischten. Wenn ich Sie als asexuales Wesen empfunden hätte, wäre ich nicht weggelaufen. Wie dem auch sei, ich bin der Ansicht, die meisten Ihrer Professoren und Lehrer werden Sie zuerst als Frau und erst in zweiter Linie als Medizinstudentin zur Kenntnis nehmen.«
Bellows sah wieder ins Feuer. Er hatte die Haltung eines Sünders nach der Beichte. Susan fühlte sich erneut von der menschlichen Wärme durchströmt, die sie seit kurzem für ihn empfand, und wie am Tag zuvor hatte sie das Verlangen, ihn zu berühren, ihn kameradschaftlich zu umarmen. Aber sie unterdrückte den Impuls und nippte weiter an ihrem Grand Marnier.
»Susan, Sie fallen in jeder Gruppe auf, und wenn Sie nicht bald in meinen Vorlesungen erscheinen, werde ich für Sie geradestehen müssen.«
»Ja, der Luxus der Anonymität ist mir nicht vergönnt, seit ich Medizin studiere. Ich versteh’ Sie ja, Mark. Trotzdem weiß ich, daß ich noch einen Tag brauche. Einen Tag noch.« Sie hielt einen Finger hoch und legte den Kopf mit übertriebener Koketterie zur Seite. Dann lachte sie. »Wissen Sie, Mark, im Grunde bin ich ja froh, daß Sie mein Los als Medizinstudentin für schwierig halten; denn es stimmt wirklich. Ein paar von den Mädels in meinem Semester verneinen das, aber sie machen sich selbst was vor. Schließlich ist das eine der beliebtesten und ältesten Lösungsmechanismen: ein Problem zu umgehen, indem man es negiert. Aber es gibt das Problem. Ich erinnere mich an ein Zitat von Sir William Osler. Der sagte, es gebe drei Klassen menschlicher Wesen: Männer, Frauen und Ärztinnen. Als ich das damals zum erstenmal las, mußte ich lachen. Heute lache ich nicht mehr.
Trotz der Feministen-Bewegung herrscht das konventionelle Bild der großäugigen weiblichen Naiven immer noch vor. Sobald man sich als Frau auf ein Gebiet wagt, das auch nur eine Spur von Durchsetzungswillen und Konkurrenzkampf verlangt, stempeln einen die Männer als Ehrgeizling ab, der ihnen an die Männlichkeit will. Wenn man sich aber brav zurücklehnt und es mit passivem, einnehmendem Wesen und weiblichem Charme versucht, heißt es gleich, Frauen könnten eben im harten Wettbewerb nicht mithalten, es sei denn, mit den unfairen Mitteln des Sex. Da bleibt einem gar nichts anderes übrig, als irgendwo in der Mitte einen Kompromiß zu suchen, und das ist um so schwieriger, als man sich dauernd auf der Anklagebank fühlt. Nicht als Individuum, sondern als Repräsentantin der gesamten Weiblichkeit.«
Susan unterbrach sich, und beide hingen dem Sinn des Gesagten nach.
»Was mir am meisten zu schaffen macht«, fuhr sie fort, »ist die Vermutung, daß die Problematik immer größer wird, je weiter man in die Medizin eindringt. Ich kapiere überhaupt nicht, wie Frauen mit Familien das schaffen. Sie müssen sich entschuldigen, wenn sie den Arbeitsplatz früher verlassen, und zu Hause müssen sie Abbitte leisten, daß sie so spät kommen, ganz egal, wieviel Uhr es ist. Der Mann kann Überstunden machen, kein Problem. Im Gegenteil, man sagt dann mit Hochachtung: Er geht ganz in seinem Beruf auf. Aber eine Frau, eine Ärztin? Ihre gesellschaftliche Rolle ist völlig diffus … Aber, wie haben Sie mich eigentlich auf dieses Thema gebracht, Mark?« Susan ging plötzlich auf, mit welcher Vehemenz sie sich in ihre Streitrede gestürzt hatte.
»Eigentlich fing es damit an, daß Sie mir zustimmten, wie schwer es eine Medizinstudentin hat. Wie wär’s denn, wenn wir über die Schlußfolgerung, man sollte nicht noch zusätzliche Hindernisse aufbauen, ein Abkommen schlössen?«
»Du liebe Güte, Mark, drängen Sie mich doch nicht so, nicht gerade jetzt. Sie müssen doch merken: Ich hab’ mich so sehr in die Sache verbohrt, daß ich einen Ausweg finden muß. Wie gern würd’ ich diesem Harris zeigen, was eine Frau in der Medizin fertigbringt. Wenn ich Berman noch einmal sehen kann, möglich, daß ich dann einen Weg finde, die Sache an den Nagel zu hängen, ohne daß ich mein Gesicht verliere. Mark, hätten Sie was dagegen, wenn ich Sie umarme?«
»Ich?
Weitere Kostenlose Bücher