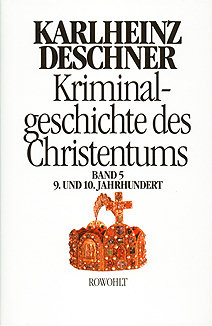![Kriminalgeschichte des Christentums Band 05 - Das 9 und 10 Jahrhundert]()
Kriminalgeschichte des Christentums Band 05 - Das 9 und 10 Jahrhundert
tradierte Ritual der Reichsversammlungen: 901 in Regensburg, 903 in Forchheim, 906 in Tribur; wie Ludwig bei Beurkundungen auch eigenhändig den Vollziehungsstrich in das Königsmonogramm setzte. Aber zum selbständigen Regieren gelangte der überdies Kränkelnde nie. Und gab es auch einige »königsnahe« Magnaten, wie die Konradiner, Verwandte der mütterlichen Seite des jungen Königs, oder den bayerischen Markgrafen Liutpold, einen weitläufigeren väterlichen Verwandten, die Reichspolitik bestimmten vor allem Vertreter des Klerus. Es war »eine rein bischöfliche Regierung« (Nitzsch). »Von der Tätigkeit der Laienfürsten im Reichsregiment melden die Annalisten nichts« (Schur). Und auch unter den »Intervenienten«, den »Fürsprechern«, das heißt jenen Hochgestellten, auf deren Rat, Empfehlung, Einflüsterung das königliche Kind Rechte verleiht, Güter schenkt, Krongüter tauscht, standen an erster Stelle Geistliche.
Selbstverständlich verkehrten auch die weltlichen Großen am Hof, nicht zuletzt gerade Graf Konrad der Ältere vom Lahngau (der Vater Konrads des Jüngeren, des späteren Königs Konrad I.) und sein Bruder Gebhard. Wuchs ja überhaupt ein potenteres Adelsregiment heran, häufiger konkurrierende Partikulargewalten, aus denen Herzöge und Herzogtümer hervorgingen; doch eben jetzt eine Prälatenregentschaft darüber. Die Bischöfe begleiteten den jungen Regenten – nicht mehr als ihre Marionette – auf Schritt und Tritt. Und anders als manch weltliche Magnaten waren sie auch auf allen seinen Zügen dabei. So blieb Ludwig das Kind wohl bis zu seinem frühen Tod völlig unselbständig, abhängig von den führenden Männern, hohen Klerikern mit nicht geringen Eigeninteressen. 5
Einen maßgeblichen Regierungsanteil hatte freilich kaum mehr als ein halbes Dutzend von ihnen; allen voran der schon von Arnulf eingesetzte Erzbischof Hatto und Bischof Salomo III.
Hatto I. von Mainz (891–913), sehr aktiv, intelligent, verschlagen, damals eine Art »Papst für Deutschland«, wie Wolfgang Menzel einst schrieb, war unentwegt politisch tätig, ohne dabei den Nutzen seiner Kirche und seiner selbst zu vergessen; das hängt ohnedies gewöhnlich eng, fast untrennbar zusammen. Schwäbischem Adel entstammend, stützte der um 850 Geborene zuerst mit seiner Sippe Karl den Dicken, nach dessen Sturz sofort Arnulf von Kärnten, was sich auch schnell auszahlen sollte: noch 888 und 889 wird Hatto mit den äußerst begüterten Abteien Reichenau und Ellwangen begabt und erhält zwei Jahre danach das Erzbistum Mainz, eine Kirchenprovinz, die sich als größte des ostfränkischen Reiches von Sachsen bis Schwaben, von der Elbe bis zu den Alpen erstreckte. So kam den Mainzer Bischöfen (die auch, erstmals seit 870, dauernd seit 965, das Erzkanzleramt, die königliche Kanzlei leiteten) eine Spitzenstellung im Staat zu; sie galten als »Königsmacher«.
Bald nach Ludwigs Regierungsantritt versteht es Hatto, noch das reiche Kloster Lorsch (Lauresham) zu bekommen, obwohl Arnulf die Selbständigkeit des von Karl I. zum Königskloster erhobenen, von Ludwig dem Deutschen mit wertvollem Reichsbesitz beschenkten Lorsch garantiert hatte; eines Klosters, das von der Nordsee bis zum Bodensee begütert war und ab 766 rund 100 Schenkungen pro Jahr erhielt! Schließlich verdankt Hatto auch das Kloster Weißenburg der Fürstengunst.
Der Mainzer Erzbischof bewegte sich mit Vorliebe in Herrschernähe. Er wurde 893 einer der beiden Taufpaten des jungen Königs, begleitete Arnulf auch auf seinen Italienzügen 894 sowie 896 zur Kaiserkrönung, war maßgeblich beteiligt 899 bei dem hinterhältigen Treffen mit Zwentibold in St. Goar (S. 319) und der Wahl Ludwigs im folgenden Jahr; nicht zu vergessen seinen Vorsitz auf der wichtigen Synode 895 während der großen Reichsversammlung in der Königspfalz Tribur bei Mainz (S. 298 ff.). Kurz, Erzbischof Hatto, schon zu Arnulfs Zeiten »das Herz des Königs« genannt, erscheint jetzt als der faktische Regent. 6
Von kaum viel minderer Bedeutung für das Regierungsgeschäft unter Ludwig dem Kind wurde Bischof Salomo III. von Konstanz (890–919), in den letzten Jahren des Königs der eigentliche Leiter der Kanzlei, seit 909 auch mit dem Titel des Kanzlers. Salomo war ein enger Freund des einflußreichen Hatto und bemerkenswert skrupellos. In Schwaben schaltete er als der mächtigste Feudalherr des Landes zweimal brutal die Herzogsprätendenten aus (S. 366 ff.).
Beide Bischöfe repräsentierten
Weitere Kostenlose Bücher