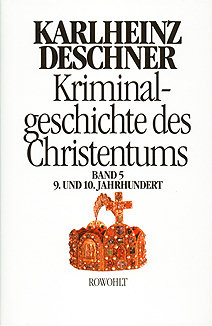![Kriminalgeschichte des Christentums Band 05 - Das 9 und 10 Jahrhundert]()
Kriminalgeschichte des Christentums Band 05 - Das 9 und 10 Jahrhundert
verlangte Anteil an ihren Einkünften und sprang auch, wie einst Karl Martell, etwas eigenmächtig mit ihrem Besitz um. So zog er, etwa zwischen 907 und 914, ihre Güter ein, weshalb der Klerus ihm, der den zusätzlichen Namen »der Gerechte« bekam, den Beinamen »der Böse« gab. Seitdem hängt dem »Zerstörer der Kirchen«, dem »Feind der Kirche«, die böse Benennung an, auch wenn Arnulf durch die umfangreiche Konfiskation kirchlicher Liegenschaften nicht nur seine militärische Schlagkraft gestärkt, sondern auf Jahrzehnte auch den Frieden mit den Ungarn erkauft, freilich zugleich seiner Vasallen Besitzgier befriedigt hat. 6
Arnulf von Bayern hatte schon früh den Herzogstitel angenommen, betont eigenständig Politik gemacht, auch gegenüber dem König deutlich Distanz bewahrt. Um den Aufmüpfigen mehr an sich zu binden, heiratete Konrad 913 die aus Schwaben stammende Mutter Arnulfs, Kunigunde, die Witwe Liutpolds von Bayern und Schwester der Grafenbrüder Erchanger und Berthold. Doch als Erchanger 914 Konrads Kanzler, Bischof Salomo, gefangennahm und Arnulf für seine schwäbischen Onkel Partei ergriff, vertrieb ihn der König mit Hilfe von bayerischen Bischöfen und Äbten: dem Erzbischof Pilgrim von Salzburg, seit 912 Konrads Erzkaplan, den Bischöfen Tuto von Regensburg, Dracholf von Freising, Udalfried von Eichstätt, Meginbert von Seben. Kurz, die bayerische Kirche stand in diesem Krieg »durchweg auf der Seite des Königs« (Handbuch der Europäischen Geschichte).
Herzog Arnulf suchte und fand darauf Zuflucht beim Landesfeind, bei den Ungarn. Und als er 916 wieder kam, verjagte ihn der König abermals, beraten jetzt und begleitet sogar von dem sächsischen Bischof Adalward von Verden, einem »Slawenmissionar«. An der Spitze zahlreicher Truppen in Bayern eindringend, brandschatzte König Konrad – »ein stets milder und weiser Mann und Liebhaber der göttlichen Lehre« (Erzbischof Adalbert) – wie in Feindesland. Er schlug Arnulf, eroberte dessen Hauptstadt Regensburg, die teilweise in Flammen aufging und deren Bischof Tuto offenbar zu Arnulfs entschiedensten Gegnern gehörte. (Tuto wurde auch Seliger seiner Kirche.) Konrad setzte in Bayern seinen Bruder und Mitkämpfer Eberhard als Statthalter ein. Und während die weltlichen Großen mehr und mehr aus der Umgebung des Königs verschwanden, stand der bayerische Episkopat selbstverständlich zum Sieger.
Zwar konnte Arnulf sein Herzogtum 917 zurückerobern, Konrads Bruder Eberhard vertreiben. Ja, er gewann jetzt auch seine Bischöfe wieder, zumal er sehr selten sie, sondern die von ihnen beneideten reichen Klöster geschröpft und die Bischöfe an der Beute beteiligt, also die Klöster – »mit den Prälaten zusammen« (Prinz) – rigoros säkularisiert hatte. Bei seinem Tod aber, am 14. Juli 937, rächte sich der Himmel, und dies, wie üblich, mit Hilfe der Hölle. Wurde doch Arnulfs Leichnam, mitten aus einem Regensburger Gelage heraus, vom Teufel geholt und in ein nasses Grab, einen See bei Scheyern gestürzt. Dies weiß jedenfalls der Chronist des Klosters Tegernsee, das schon im späten 8. Jahrhundert 15 Pfarrkirchen besaß und dessen Ländereien, bereits damals bis Tirol und Niederösterreich gestreut, Arnulf beschlagnahmt hatte, offenbar auch zugunsten des Bistums Passau. 7
Genoß aber Herzog Arnulf »der Böse« den schlechtesten Ruf bei den Mönchen, zog es König Konrad I. stark zu ihnen hin. Oft besuchte er Klöster, St. Gallen und Lorsch, Korvei und St. Emmeram, Fulda und Hersfeld, und meistens vermehrte er dann durch Vergabungen deren Besitz.
Mörderbischof Salomo triumphiert
Aus dem Kloster kam auch jener Oberhirte, auf den sich König Konrad im Süden seines Reiches vor allem stützte, Salomo III. von Konstanz, einer jener ungezählten Prälaten, die ihr Amt, ihre »Berufung« ihrer Familie verdanken. Der Nepotismus, eine Spielart feudaler Sippenpolitik, ist besonders »berühmt und berüchtigt« bei den Päpsten durch fast alle Jahrhunderte, wobei er im 15., 16., 17. den »Höhepunkt erreicht« (Schwaiger). Natürlich findet sich das Phänomen auch bei anderen Kirchenfürsten, Domkapiteln, Großklöstern. »Immer wieder lesen wir, wie Bischöfe, Äbte und Äbtissinen ihre Verwandten im Amt nachfolgen lassen. Ja, sogar ganze Diözesen haben sich über Generationen gleichsam im Besitz von Adelssippen befunden« (Angenendt).
In Konstanz nun regierten zwischen 838 und 919 drei Bischöfe derselben hochadligen alemannischen Familie:
Weitere Kostenlose Bücher