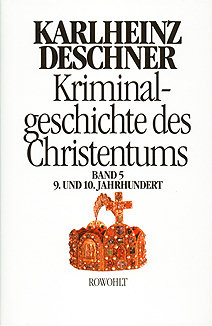![Kriminalgeschichte des Christentums Band 05 - Das 9 und 10 Jahrhundert]()
Kriminalgeschichte des Christentums Band 05 - Das 9 und 10 Jahrhundert
Stamm, sind fast alle dem sächsischen Fürstenhaus besonders verbunden. Und sie berichten sämtlich aus einer späteren Zeit.
Der ungesalbte König tritt an
Heinrich I., um 876 geboren, wurde Mitte Mai 919, im Alter von fast 45 Jahren, in Fritzlar (Nordhessen), einst Stützpunkt der Mission des Bonifatius, von Sachsen und Franken zum König gewählt. Auf fränkischem Boden, doch nah dem Sachsenland, überantworteten sie dem neuen Herrn »unter Tränen vor Christus und der ganzen Kirche als unverbrüchlichen Zeugen, was ihnen anvertraut war« (Thietmar von Merseburg). Die fränkischen Großen sollen, wie neuerdings vermutet, ihn gar schon vorher zu ihrem König erkoren und ihm gehuldigt haben. Schwaben und Bayern fehlten; erst recht die Lotharingier. Die Schwaben standen gerade gegen Rudolf II. von Hochburgund (912–937) im Kampf, der offenbar nach Nordosten expandieren wollte. Die Bayern hatten seinerzeit König Konrad geschlagen, ja, in den Tod geschickt (S. 369 f.) und ihren Herzog Arnulf »den Bösen«, vermutlich zusammen mit einigen Mainfranken, zum König gemacht – wann, ob vor oder nach Konrads Erwählung, ist offen und somit auch, wer wessen »Gegenkönig« war.
Jedenfalls verging bis zu Heinrichs Erhebung fast ein halbes Jahr nach Konrads Tod, was Probleme indiziert. Schließlich hatte der neue Herrscher als Nichtkarolinger, sogar Nichtfranke gleich ein doppeltes Legitimationsdefizit. Umso erstaunlicher, daß er, was allein Widukind berichtet, der »ungesalbte König« wurde, und zwar aus eigenem, ganz persönlichen Entschluß. War er vielleicht, trotz neuerer Abschwächungsversuche, zunächst doch etwas weniger klerushörig als sein Vorgänger, der die Kirche zum Kampf gegen die Herzöge und Prätendenten genutzt, was den Bischöfen wiederum mehr Einfluß verschafft hatte? Wie auch immer, Heinrich, angeblich solcher Ehre unwert, ließ sich nicht salben, was ihm der Mainzer Metropolit Heriger (913–927) angeboten, natürlich aus Prestigegründen, Machtkalkül. War ja die kirchliche Benediktion des Königs seit der Zeit des besonders klerusergebenen Ludwig IV. auch in Ostfranken üblich geworden.
Heinrich aber wollte nicht als Gegner der Herzöge erscheinen, als Fortsetzer von Konrads gescheiterter Politik, kurz gesagt als Mann des Episkopats. So stützte er sich, ohne im geringsten antiklerikal, auch nur antiepiskopal zu sein, zunächst bloß auf einen einzigen, gleichsam von seinem Vorgänger übernommenen Notarius (Simon), statt auf die traditionelle geistliche Kanzlei, mit deren Aufbau er zögerte. Und während Konrad mit dem Klerus eng kooperiert hatte, erstrebte Heinrich, mehr als primus inter pares, ganz allgemein die Zusammenarbeit mit den weltlichen »maiores« des Reichs, natürlich zugunsten von dessen Einheit und Schlagkraft.
Diese Integrierung gelang ihm zuerst 919 mit dem schwäbischen Herzog Burchard, der das jüngste und noch am wenigsten gefestigte Herzogtum anführte und sich überdies gerade in einem ernsten Konflikt mit dem benachbarten Burgunderkönig Rudolf II. befand (der über die von ihm eroberte Pfalz Zürich in den Bodenseeraum vorzustoßen begann; mit großen Königsgütern, der Pfalz Bodmann, der Abtei Reichenau, der Bischofsstadt Konstanz, das damalige Herz Schwabens). Und mit dem Bayernfürsten Arnulf, der wohl mehr ein bloß bayerisches Königtum beabsichtigte, arrangierte er sich 921 – nach einem ersten mißglückten, einem zweiten unentschiedenen Kriegszug.
Heinrich war bis vor Regensburg gezogen, vermied jedoch eine Entscheidungsschlacht. Denn anders als sein Vorgänger Konrad I. suchte das »Genie entschlossenen Zauderns« in der Regel nicht den offenen Schlagabtausch. »Er droht, hochgerüstet, aber er schlägt nur ungern zu« (Fried). Das gilt freilich mehr für seine Innen-, gewiß nicht für seine Ostpolitik. Gegenüber den Herzögen seines Reiches indes verhandelt er lieber, macht Kompromisse. So überläßt er beiden süddeutschen Fürsten das auf ihrem Gebiet liegende Fiskalgut, er gestattet ihnen die Kirchenherrschaft, die Verfügung über die Bischofssitze und Reichsklöster, erteilt vielleicht sogar einige außenpolitische Befugnisse; natürlich all dies einzig und allein, weil ihm die Macht fehlte, völlig zu unterwerfen; aber er wurde anerkannt. Und als er mächtiger, seine Position stabiler war, da griff er auch das Problem der Kirchenherrschaft auf und verband sich immer enger mit dem Klerus (S. 382 ff.). 6
Lukrative Bräute und ein gefügiger
Weitere Kostenlose Bücher