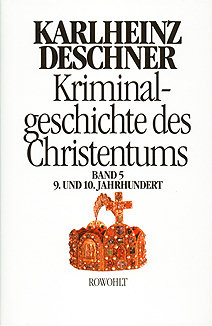![Kriminalgeschichte des Christentums Band 05 - Das 9 und 10 Jahrhundert]()
Kriminalgeschichte des Christentums Band 05 - Das 9 und 10 Jahrhundert
Bischof
Die Regierung des ersten deutschen Königs zeigt einmal mehr den Angelpunkt der Politik. »Der König aber wuchs und nahm zu an Macht von Jahr zu Jahr«, rühmt Widukind von Corvey. Macht – und je mächtiger ein Mächtiger, desto tiefer beugen sich, jedenfalls in der Regel, worum es hier stets geht, die Geschichtsschreiber vor ihm.
Heinrich I. sorgte zunächst durch eine reiche Frau für Stärkung seiner Position. Im Alter von etwa 25 Jahren warb er um Hatheburg, die Erbtochter des söhnelosen Grafen Erwin von Merseburg. Auf ihren auch politisch bedeutsamen Besitz – ein Ausfalltor nach Osten, mit weiten Ländereien in jenem Raum – war freilich (in Gestalt Hattos I.) auch die Kirche scharf, unter deren Einfluß die verwitwete Hatheburg offenbar den Schleier genommen. Und so eigensüchtig, wie der Klerus sie ins Kloster gebracht haben mochte, so eigensüchtig holte sie Heinrich, »ob ihrer Schönheit und der Brauchbarkeit ihres reichen Erbes«, auch wieder heraus, heiratete sie und zeugte mir ihr seinen Sohn Thankmar.
Aber, verrät Thietmar von Merseburg wieder, »die Liebesleidenschaft des Königs zu seiner Gemahlin nahm ab«. Und da traf es sich gut, daß der »wackere«, »kluge«, der »so rechtschaffene« Bischof Siegmund von Halber Stadt (894–924), dieser »Gipfel vollkommenen Strebens«, die Rechtmäßigkeit der Ehe anfocht. Unterstellte doch der »im Eifer für Christus erglühende Mann«, der überdies »durch vielseitige Kenntnis geistlicher und weltlicher Wissenschaft damals alle Zeitgenossen überragte«, ein Heinrichs Ehe ausschließendes früheres Gelübde Hatheburgs. Ergo verbot er beiden prompt »die weitere eheliche Gemeinschaft kraft der Banngewalt apostolischer Bevollmächtigung«. Worauf der folgsame katholische Fürst ja gar nicht anders konnte, als die unkanonische Ehehälfte zu verstoßen.
Dabei traf es sich einmal mehr gut, daß Heinrich bereits »ob ihrer Schönheit und ihres Vermögens für die junge Mathilde« erglühte. Also sperrte er die erste Gattin bald wieder ins Kloster, selbstverständlich unter Zurückbehaltung ihres reichen Brautschatzes, großer in Ostsachsen gelegener Ländereien – ein Grundstock des beträchtlichen ottonischen Königsgutes um Merseburg. Und wie Heinrich damit seine Macht nach Osten vergrößert hatte, weitete er sie nun, durch eine zweite Ehe, nach Westen aus. Er heiratete im Jahr 909 die Tochter des Grafen Thiederich, die junge Mathilde, wegen »ihrer Schönheit und ihres Vermögens« (Thietmar), zudem berühmt durch ihre Abstammung (wenn auch nicht in der männlichen Linie) von dem sächsischen Heroen und Widersacher Karls im Sachsenkrieg, Widukind. Mathilde war seine Urenkelin und überdies, so ihr Biograph, »höchsten Lobes wert«, natürlich auch wieder höchst begütert, eben durch das westfälische Erbe der Widukinde. Und selbstverständlich war auch sie wieder sehr der Kirche ergeben, kurz: »in religiösen wie in weltlichen Dingen wertvoll« (in divinis quam in humanis profuit: Thietmar).
Erneut holte sie Heinrich, jetzt offenbar mit Hilfe seines Vaters, des Herzogs Otto, Laienabtes in Hersfeld, aus einem Nonnenkloster, diesmal aus Herford, wo sie, angeblich ohne für den geistlichen Stand bestimmt zu sein, eine gleichnamige großmütterliche Äbtissin erzog. »Sie trat hervor, die schneeigen Wangen von flammender Röte übergossen, als wären weiße Lilien mit roten Rosen vereint« (Vita Mathildis). Schon einen Tag nach seiner Ankunft in dem hl. Haus soll Heinrich mit seiner Beute davongezwitschert sein. Und ihre Morgengabe brachte ihm nun einen Einflußgewinn in Ostfalen und Engern. 7
Daß dieser Mann, dem die Sage dann durch die Zeiten als »Heinrich dem Vogler«, als »König am Vogelherd«, eine gewisse unhöfische Haltung, eine beinah bäuerliche Bescheidenheit zusprach, auch als König nicht zu kurz kam, versteht sich von selbst. Sogar Bischof Thietmar, der doch Heinrichs »Tüchtigkeit«, »große Leistungen« rühmt, »die ewiger Erinnerungen würdigen Taten unseres Königs«, räumt ein: »Wenn er sich während seines Königtums, wie viele behaupten, bereichert hat, möge es ihm der barmherzige Gott verzeihen.« 8
»Verbrüderungsbewegungen« und Pfaffennähe
Daß Heinrich nach seiner Wahl die Salbung verweigerte, hat den Klerus anscheinend befremdet, zumal das Einsetzen des Königs stets Rechte des Königsmachers erzeugte. Also raunte dem hl. Ulrich – Heinrich gab ihm 923 das Bistum Augsburg – der Apostelfürst
Weitere Kostenlose Bücher