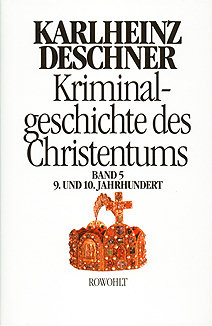![Kriminalgeschichte des Christentums Band 05 - Das 9 und 10 Jahrhundert]()
Kriminalgeschichte des Christentums Band 05 - Das 9 und 10 Jahrhundert
Petrus persönlich ins Ohr: »Melde dem König Heinrich, daß jenes Schwert ohne Handgriff einen König darstellt, der ohne bischöflichen Segen (sine benedictione pontificali) sein Reich regiert, das Schwert mit dem Knauf aber einen König, der das Steuer des Reiches mit göttlichem Segen hält« (Vita Oudalrici). Woraus sich für Heinrich der Name »ensis sine capulo« (Schwert ohne Griff) entwickelte.
Diese Prälatenlehre durfte Heinrich nicht allzu lange mißachten. Um so weniger, als die Bischöfe im Lauf des 9. und 10. Jahrhunderts immer mehr Rechte erhalten hatten und erhielten, sogar solche, die ursprünglich dem König eigneten, bis selbst die Grafschaften an sie kamen – all dies vermutlich weit wichtiger für den Monarchen als der Rat des hl. Petrus und dessen Auftreten vor einer ganzen Synode!
Dabei war Heinrich keineswegs grundsätzlich antiklerikal. Vielmehr wandte er sich nach wenigen Jahren, nach dem vergeblichen Versuch, die bischöfliche Macht in Deutschland zu beschneiden – Albert Hauck behauptete einst geradezu: »am Hofe keines anderen Königs waren die Bischöfe so einflußlos wie an dem Heinrichs« –, immer mehr der Kirche zu. Die geistlichen Chronisten rühmen ihn deshalb. Heinrich erbaute Gotteshäuser in Sachsen, wo er offenbar mit den Landesbischöfen »in bestem Einvernehmen stand« (Eibl). Er trat samt Familie auch der Gebetsgemeinschaft wichtiger Klöster bei, in Fulda, St. Gallen, auf der Reichenau, im südlotharingischen Vogesenkloster Remiremont. Überschwemmte doch seinerzeit – Zeiten der Not! – eine ganze Verbrüderungsflut des Adels mit den Klöstern das Land, letztlich nichts anderes als eine vertragliche Vereinbarung von laikalen und geistlichen Personen zwecks gegenseitigen Beistandes, selbstverständlich auch in der Fehde. Bezeichnenderweise kam es zu regelrechten »Verbrüderungsbewegungen« besonders bei der Mission und Ausbreitung der Kirche in den christianisierten Ländern.
Ganz ähnlich verhielt es sich mit den florierenden Freundschaftsbündnissen. Zumal Heinrichs Amicitia-Pakte mit den Herzögen, mit »gemachten Freunden«, wodurch er seine Herrschaft wesentlich zu sichern suchte, entsprangen einem rein opportunistischen Kalkül, waren offensichtlich Integrationsbestrebungen, »Bündnispolitik zu Herrschaftssicherung« (Beumann), im Grunde nur eine eigensüchtige Kumpanei der Fürsten und des Hochadels. Derartige Partnerschaften mit den Großen des Reichs – die dann Otto I. verweigerte – schloß Heinrich mit den Herzögen Eberhard von Franken, Arnulf von Bayern, Giselbert von Lotharingien, auch mit seinem Vorgänger Konrad, mit König Rudolf von Hochburgund und mehreren westfränkischen Königen. Schließlich war »Rat und Hilfe« auch eine Formel der »konstruierten« Freundschaft gegenüber der »geborenen«, der Blutsverwandtschaft, mit der es im Christentum, wie schon oft gezeigt, nicht weit her war.
Im übrigen verband sich Heinrich I. immer enger mit der Reichskirche, ja, er soll bald nichts ohne die Befragung von Bischöfen unternommen haben, die bei ihm »fortwährend eine hervorragende Stellung« einnahmen (Waitz). Schon 921, als ihm Karl der Einfältige die Hand des hl. Dionysius gab (den man zwar im Mittelalter für eine Person hielt, der aber, wie wir heute wissen, aus der Mixtur von drei verschiedenen Personen entstand), hatte er, auf Rat eines bayerischen Prälaten, einen längeren Feldzug gegen den Bayernherzog Arnulf geführt, den die Kirche als den Bösen, als Tyrannen und Sohn der Verderbnis verschrie, dessen große Säkularisationen aber zum Teil bereits Herzog Berthold, Arnulfs Bruder, wieder rückgängig machte. Schon 922 ernannte Heinrich den Erzbischof Heriger von Mainz, dessen Salbungsofferte er doch abgewiesen, offiziell zu seinem Erzkapellan und umgab sich immer mehr mit Oberhirten und Äbten, die in den Königsurkunden ebenfalls stark überwogen. Auch übergab er (929) seinen vierjährigen Sohn Brun dem Bischof Balderich I. von Utrecht zur Erziehung und bestimmte ihn für die bischöfliche Laufbahn.
Die »Heilige Lanze«
Schließlich erwarb Heinrich nach monatelangem Ersuchen, Fordern, Drohen von König Rudolf II. von Hochburgund 926 für Gold, Silber sowie, als weitere Gegengabe, einen »nicht geringen Teil des Schwabenlandes«, Basel, die mit einem vermeintlichen Nagel vom Kreuz Christi ausgestattete, siegverheißende Heilige Lanze, angeblich ein Symbol für den Anspruch auf Italien.
Das kostbare Stück nahm unter den
Weitere Kostenlose Bücher